IMPRESSUM
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Gottesbilder
in der Kulturgeschichte
Hartmut Schönherr
Der Begriff "Gottesbilder" meint im allgemeinen Gebrauch inhaltlich gefasste Gottesvorstellungen, Konzepte einer Entität, die ein jeweiliges Glaubenskollektiv begründet. Diese Konzepte können sich je nach Kulturkreis, politischem Framing, gesellschaftlichem Kontext und konkreter Aktualisierung erheblich unterscheiden, selbst da, wo "der gleiche Gott" gemeint sein mag, wie im avancierten interreligiösen christlich-islamischen Dialog.
Für den substanzialistisch orientierten Religionswissenschaftler Gustav Mensching steht hinter allen Gottesbildern die gemeinsame "Erfahrung des Heiligen", sie meinen ihm zufolge eine und die gleiche Entität. Und so nennt er in seiner bemerkenswerten religionsgeschichtlichen Publikation von 1960 alle Verkünder, Propheten, Religionsgründer "Söhne Gottes" - die "Töchter" im Banne der Überlieferungsgeschichte ignorierend. Gleichwohl ist seine Arbeit ein gutes Sprungbrett für die übergreifende Beschäftigung mit Gottesvorstellungen.
Gewiss kann das Wort "Gottesbilder" auch Abbildungen, bildliche Konkretionen einer jeweiligen Gottesvorstellung benennen - wofür in der Regel allerdings Ausdrücke wie "körperliche Darstellung des Göttlichen" oder "bildliche Darstellung Gottes" verwendet werden. Auf dieser Seite geht es um Konzepte. Konkrete Bilder, Abbildungen werde ich nur ergänzend einstreuen, sie den Kurzessays zu Gottesvorstellungen beigesellen. Dem eingedenk, dass diese Bilder stets Konzepte zur Grundlage haben, sie deuten, stützen, kommunizieren.
Im Fokus steht jeweils entweder ein Prinzip, eine sich auch in Götterpluralitäten durchhaltende oder aufscheinende Macht, Entität, Wesenheit - oder eine in einzelnen Gottheiten oder Gottesvorstellungen konkretisierte spezifische Auffassung des Numinosen von übergeordneter Bedeutung. Ich folge dabei meinen eigenen Interessen und Erfahrungen, bin aber auch bemüht, einen leitenden Überblick zu bieten, ein bruchstückhaftes Mosaik dessen, was historisch partikular "Gott" hieß oder bedeuten konnte.
Allen hier vorgestellten Gottesbildern gemeinsam ist eine monotheistische Tendenz. Auch wenn noch immer oft zu lesen ist, der (jüdisch-christliche) Monotheismus sei eine Weiterentwicklung aus dem (frühhistorischen bzw. griechisch-römischen) Göttergewimmel: Ich folge hier heuristisch der neueren Auffassung, dass die Unterscheidung Monotheismus versus Polytheismus keine substantielle Grundlage habe, dass diese beiden Kategorien unterschiedliche funktionale Ansprüche an Religion reflektierten. Sie können so nebeneinander Anwendung finden, als Konstruktionen unterschiedlicher Perspektiven.
Von einer historischen Abfolge im Sinne einer "Höherentwicklung" kann daher nicht ausgegangen werden. Darauf hat z.B. schon früh der Iranist und Religionswissenschaftler Helmut Humbach (1921-2017) hingewiesen. Nach seinen Forschungen existierte bereits im frühen Hinduismus eine starke Tendenz zum Monotheismus mit der Figur des Asura Varuna - diese Tendenz wurde dann ihm zufolge aufgegeben, ja von der Priesterschaft unterdrückt.
Lektüreempfehlung: Gustav Mensching, Die Söhne Gottes. Aus den Heiligen Schriften der Menschheit, Wiesbaden: Löwit, 1960
Abbildung: Druck aus der Hiob-Serie Gustave Dorés.
INHALT
Sintflutbericht - Kubaba - Mutter Erde - Echnatons Aton - Altes Testament - Mithras - Enūma eliš - Brahman-Atman - Hieros Gamos - Ahura Mazda - Buddha - Neues Testament - Manichäismus - Islam - Das Dritte Reich des Geistes - Zimzum - Spinozas Deus sive natura - Schellings Werdender Gott - Friedrich Nietzsche: Der Tod Gottes - Der persönliche Gott bei Edith Stein - Simone Weil und der abwesende Gott - Die Namen Gottes - Der Fall Rautavaara
Die Reihung der Texte folgt einem groben zeitlichen Muster, das angesichts der oft unklaren oder unzureichenden Befunde, der Gleichzeitigkeiten und Überlappungen sowie der komplexen geschichtlichen Entwicklung der Konzepte in Wechselbeziehungen nicht zu eng genommen werden darf.
Sintflut - Strafender und helfender Gott
Der älteste überlieferte Sintflut-Bericht findet sich auf
der 11. Tafel des Gilgamesch-Epos. Das Epos ist wohl in der
Spätbronzezeit, ab etwa 1.800 vor Christus, entstanden und
zuletzt etwa 1.200 vor Christus überarbeitet, von
Sin-leque-unnini, überliefert in sumerischer Keilschrift.
Erhalten sind vor allem große Teile der Tafeln von 1.200,
aber auch Fragmente des Urtextes.Gilgamesch (ein legendärer König von Uruk, erstmals belegt 2.600 v. Chr., zu zwei Dritteln Gott, einem Drittel Mensch) berichtet von seinem Vorfahr Utnapischtim (Uta-napischti), von dem er das Geheimnis der Unsterblichkeit erwartet hatte, die Götter, allen voran die oberste Gottheit Enlil, Sohn von An, hätten eine Sintflut gesandt, die sechs Tage währte und am siebten Tag zur Ruhe kam. Utnapischtim sollte auf Anraten von Ea ein Schiff bauen, um für die Menschen, die keine "Sünder" und "Frevler" waren, das Überleben zu sichern (11. Tafel, Kolumne IV). Er belud das Schiff mit Silber und Gold und "mit allerlei Lebenssamen", nahm seine "ganze Familie und Verwandtschaft, Vieh des Feldes, Getier des Feldes (und) alle Werkleute" mit (11. Tafel, Kolumne II). Damit begründete er eine neue Schöpfung, nachdem er mit seiner Arche sieben Tage auf dem Berg Nissir festen Grund gefunden hatte (11. Tafel, Kolumne III). Utnapischtim und seine Frau werden dann von Ea zu Göttern erklärt (11. Tafel, Kolumne IV) - während später bei Noah nur ein "neuer Bund" zwischen Gott und den Menschen geschlossen wird.
 Das hier aufscheinende
Gottesbild ist höchst diffus, Menschen, Helden und Götter
sind nicht scharf geschieden, die Welten greifen ineinander,
Hierarchien sind flüchtig, jede Stadt besitzt eine eigene
zentrale Gottheit, Streit unter den Göttern scheint Alltag.
Eine herausragende Rolle spielt allerdings Ea/Enik, höchste
Gottheit der Stadt Eridu, der vermutlich ältesten
sumerischen Stadtgründung, mit Verweisen zurück ins 6.
vorchristliche Jahrtausend. Ea ist Schöpfergott,
Weisheitsgott und dem Süßwasser zugeordnet. Auf ihn geht
letztlich die Neubegründung der Menschheit nach der Sintflut
zurück. Und bemerkenswerterweise werden Utnapischtim und
seine Gattin nicht als seine Kinder angesehen (wie wir das
zeitgleich aus Ägypten kennen), sondern bleiben autonome
Wesen, deren Erhebung zu Göttern durch Ea primär dem Zweck
zu dienen scheint, die Menschheit zu erhalten.
Das hier aufscheinende
Gottesbild ist höchst diffus, Menschen, Helden und Götter
sind nicht scharf geschieden, die Welten greifen ineinander,
Hierarchien sind flüchtig, jede Stadt besitzt eine eigene
zentrale Gottheit, Streit unter den Göttern scheint Alltag.
Eine herausragende Rolle spielt allerdings Ea/Enik, höchste
Gottheit der Stadt Eridu, der vermutlich ältesten
sumerischen Stadtgründung, mit Verweisen zurück ins 6.
vorchristliche Jahrtausend. Ea ist Schöpfergott,
Weisheitsgott und dem Süßwasser zugeordnet. Auf ihn geht
letztlich die Neubegründung der Menschheit nach der Sintflut
zurück. Und bemerkenswerterweise werden Utnapischtim und
seine Gattin nicht als seine Kinder angesehen (wie wir das
zeitgleich aus Ägypten kennen), sondern bleiben autonome
Wesen, deren Erhebung zu Göttern durch Ea primär dem Zweck
zu dienen scheint, die Menschheit zu erhalten.In der Forschung wird der Sintflutbericht eher als ein Exkurs des Gilgamesch-Epos angesehen. Kennen wir doch aus Mesopotamien auch andere Fassungen des Sintflutberichtes, unabhängig vom Gilgamesch-Epos, vor allem die mit dem Heldennamen Atrachasis statt Utnapischtim. Doch neuere Funde zur 10. Tafel erlauben auch eine Deutung, die dem Sintflutbericht eine Schlüsselrolle im Epos zuweist. Gilgamesch sucht die Unsterblichkeit und findet den unsterblichen Utnapischtim, der ihm auf den ersten Blick zu seinem Erstaunen vollkommen ähnlich ist. Dieser erzählt ihm, er (und seine Frau nebenbei auch) habe die Unsterblichkeit von Enlil, nach Tadel durch Ea für die Anrichtung der Sintflut durch Enlil, gleichsam geschenkt bekommen, nachdem sie die Menschheit neu begründet hatten. Unsterblichkeit als Resultat des Nicht-Aufgebens, als Resultat einer Bewährung trotz extremer Widrigkeiten? Und noch eine andere zentrale Botschaft lässt sich der 10. Tafel entnehmen. So fragt Utnapischtim den Gilgamesch, ob er sich denn schon jemals "um den einfachen Mann (...) gesorgt" habe? Seine Aufgabe als König sei doch "Erhebe du sein (des einfachen Mannes - H.Sch.) Haupt"! Müssen wir das Gilgamesch-Epos als den ersten Bildungsroman der Menschheit lesen? Der Sintflutbericht erscheint nun als zentrale Lehre für Gilgamesch, dessen Heldentaten, die Erschlagung Humbabas und die Tötung des Himmelsstiers, vor dieser Folie erheblich an Glanz verlieren, ja problematisch werden!
Spätere Sintflutberichte kennen wir auch aus anderen Kulturräumen, am prägnantesten aus dem Hinduismus mit der Figur des Vaivasvata, dessen Geschichte im Śatapatha-Brāhmaṇa und im 3. Buch des Mahabharata erzählt wird, mit ähnlichen Berichten in der Matsya-Purana und der Bhagavata-Purana, und aus dem Judentum mit der Geschichte Noahs im Alten Testament. Weniger stark literarisch überformt kennen wir Legenden einer großen Überschwemmung von den Inuit, den australischen Aborigines und vielen anderen Kulturen. Es ist noch offen, ob dahinter eine gemeinsame Katastrophen-Erfahrung, mehrere verschiedene katastrophische Ereignisse oder eine Mythenwanderung stehen.
10. Tafel zitiert nach: Stefan Maul, Das Gilgamesch-Epos, Beck, 2005
11. Tafel zitiert nach: Carl Bezold, Babylonisch-assyrische Texte. Schöpfung und Sintflut, Bonn: Marcus und Weber's Verlag, 1911
Abbildung: Gilgamesch und Enkidu erschlagen Humbaba im Zedernwald, 19.-17. Jahrhundert vor Christus
Kubaba - Tavernenwirtin und Große Mutter
Eine der ältesten namentlich bekannten weiblichen Gottheiten
ist die hurritische Kubaba (Ku-Baba, Kubabat, kbb, Kug-Bau),
dokumentiert in Kültepe/Kaniš im 19. Jahrhundert vor
Christus als Kubabat und als Stadtgöttin von Karkamiš am
oberen Euphrat vor der Eroberung durch die Assyrer als
Kubaba. Kubaba wurde mit G
 ranatapfel,
Spiegel und Getreideähren (Gerste) als Attributen
dargestellt. Ihre Symboltiere waren Adler, Stier und Löwe -
letzteres möglicherweise in Anlehnung an Ishtar. Geschrieben
wurde ihr Name mit einer Vogel-Hieroglyphe, wobei es in der
Forschung zu verschiedenen Zuschreibungen kam: Adler, Falke,
Taube. Im Anschluss an Helck, der die traditionellen
Deutungen von Fruchtbarkeitskulten und insbesondere
weiblichen Gottheiten als Fruchtbarkeitsgottheiten in Frage
stellt, könnten die Ähren auf das Bierbrauen bezogen werden.
Kybele behielt die Attribute Granatapfel und Ähren,
gelegentlich erscheint sie auch mit Löwe, und ihre Krone in
Stadtmauergestalt könnte als römische Umdeutung auf die
Kopfbedeckung der ältesten Kubaba-Reliefs zurückzuführen
sein.
ranatapfel,
Spiegel und Getreideähren (Gerste) als Attributen
dargestellt. Ihre Symboltiere waren Adler, Stier und Löwe -
letzteres möglicherweise in Anlehnung an Ishtar. Geschrieben
wurde ihr Name mit einer Vogel-Hieroglyphe, wobei es in der
Forschung zu verschiedenen Zuschreibungen kam: Adler, Falke,
Taube. Im Anschluss an Helck, der die traditionellen
Deutungen von Fruchtbarkeitskulten und insbesondere
weiblichen Gottheiten als Fruchtbarkeitsgottheiten in Frage
stellt, könnten die Ähren auf das Bierbrauen bezogen werden.
Kybele behielt die Attribute Granatapfel und Ähren,
gelegentlich erscheint sie auch mit Löwe, und ihre Krone in
Stadtmauergestalt könnte als römische Umdeutung auf die
Kopfbedeckung der ältesten Kubaba-Reliefs zurückzuführen
sein.Der Name Kubaba erscheint auf der sumerischen Königsliste als Königin unter der 3. Dynastie von Kish, etwa 2.400 vor Christus, mit dem Hinweis "Wirtin der Taverne". Andere Texte nennen die Königin "Bier-Frau". Auf der Königsliste wird später, um 2.830, ein Puzur-Suen/Puzur-Sin als Sohn von Kug-Bau geführt. Bei der Geburt von Zwittern wurden diese Kubaba zugesprochen. Es ist nicht letztlich geklärt, ob die beiden Kubabas identisch sind. Doch einige Parallelen verweisen darauf und es ist zu vermuten, dass die Königin Kubaba zur Stadtgöttin von Karkamiš über Handelsbeziehungen mit Kiš wurde. Helck weist darauf hin, dass die Ausbreitung des Kubaba-Kultes entlang von Handelsstraßen erfolgte (Helck 1971, S. 246).
Was als "Tavernenwirtin" benannt wurde, dürfen wir bei Kubaba (wie auch bei Ishtar, die gelegentlich so erscheint - etwa auf der 10. Tafel des Gilgamesch-Epos) durchaus nicht nur mit Ausschank, sondern auch mit (Tempel-)Prostitution verbinden. Berichtet wird von den Kubaba-Kulten der Zusammenhang mit blutigen und bacchantischen Ritualen. Gatte von Kubaba war Karhuha.
Es gibt Spekulationen, dass die spätere phrygische Göttin Kybele (Matar Kubile, Kybebe) mit Kubaba identisch sei. Davon geht etwa Helck aus (Helck 1971, S. 244f) - und verweist neben den Namensüberlagerungen unter anderem auf die beide auszeichnende geschlechtliche Doppelbestimmung. Allerdings spalteten sich von Kybele schon in frühen Darstellungen aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, die ikonographisch an Kubaba erinnern, Kinderfiguren ab (männlich-weiblich), später Attis als ihr Geliebter. Der Kybele-Kult verbreitete sich unter Titeln wie "Göttin vom Berg Ida" und "Große Mutter" in der ganzen Region ("kubileya" bedeutet "vom Berg"). Für Helck ist damit jedoch keine Fruchtbarkeitsgöttin benannt. Signum von Kubaba/Kybele seien nach ihm Sexualität und weibliche Machtausübung.
Auch Kybele wurde mit bacchantischen und blutigen Ritualen in Verbindung gebracht. Bis 400 vor Christus hatte sich ihr Kult im gesamten griechischen Raum ausgebreitet und 205 vor Christus zog die Göttin mit einem ihr zugeordneten Meteoriten-Brocken in Rom ein und eroberte im Gefolge das gesamte Römische Reich als "Magna Mater". In Neuss wurde 1956 ein Kybele-Kultkeller noch aus der Spätantike ausgegraben, der möglicherweise "Bluttaufen" diente.
Lektüreempfehlungen:
Wolfgang Helck, Betrachtungen zur großen Göttin und den ihr verbundenen Gottheiten, München/Wien: Oldenbourg, 1971
Sabine Viktoria Kofler, Kybele in Griechenland, in: historia.scribere 10/2018, Universität Innsbruck online
Abbildung: Relief aus Karkamiš mit einer Darstellung Kubabas mit Granatapfel und Emmer aus dem 9. Jahrhundert vor Christus
"Mutter Erde" in der Atharvaveda
Die Atharvaveda ist eine Textsammlung des Hinduismus, die
vor allem Zaubersprüche, Darstellungen magischer
Überzeugungen und Beschreibungen magischer Praktiken
enthält. Kanonisiert wurde die Sammlung als 4. Veda zu
Rigveda, Samaveda, Yajurveda erst im 3. vorchristlichen
Jahrhundert, allerdings stammen die Texte oder die Vorlagen
zu den Texten teilweise aus weit älteren Zeiten, bis zurück
an den Beginn des 2. vorchristlichen Jahrtausends. Besonders
interessant als einer der ältesten schriftlichen Belege
matriarchaler religiöser Vorstellungen ist die "Hymne an die
Erde", wie Kanda XII, Sukta 1, Mantras 1-63 der Atharvaveda
in den deutschen Übersetzungen genannt wird (ich zitiere
folgend nach Klaus Mylius, "Älteste Indische Dichtung und
Prosa"). In diesem Text gibt es deutliche Hinweise auf den
Bergbau, was nahelegt, dass er in der frühen indischen
Eisenzeit entstanden ist, zum Ende des 2. Jahrtausends vor
Christus. So heißt es im Mantra 35: "Was ich von dir, o
Erde, ausgrabe, das soll schnell zuheilen. Laß mich, o
Reinigende, nicht deine empfindliche Stelle, nicht dein Herz
durchbohren!"Die im Hymnus angesprochene "Erde" ("pṛthivī" - die Weite, das weite Land) ist weder eindeutig Schöpfung (natura naturata) noch eindeutig Schöpfungsprinzip (natura naturans). Angesprochen wird die Erde zunächst in ihrer konkreten Gestalt und Materialität - versehen mit Attributen eines nährenden, produktiven Prinzips. So wird sie im Mantra 17 explizit als "Mutter der Pflanzen" vorgestellt, an anderer Stelle (Mantra 10) als die Menschen ernährende "Mutter", noch expliziter als "Mutter Erde" ("pṛthivī mātā") im abschließenden Mantra 63. Daneben wird als ähnlich bedeutungsvoll für den Erhalt des Lebens nur noch die "aufgehende Sonne" (Mantra 15) genannt, "Verbündeter" des Menschen (Mantra 33). Prajāpati, der androgyne Schöpfergott der Veden, soll die Erde für die Menschen freundlich machen - doch seine Funktion bleibt untergeordnet, es ist die Erde, "die alles im Schoße trägt" (Mantra 43). Prajāpati ist lediglich Supplement der Erde (Mantra 61). Deren Gatte Parjanya, zuständig für den Regen, wird gleichfalls nur nebenbei gewürdigt (Mantras 12 und 42). Erwähnt wird auch Agni, die Feuergottheit, allerdings nur in den vermutlich nachträglich eingefügten Mantras 19 und 20. Alle Götternamen, selbst der Vishnus (Mantra 10), erscheinen lediglich enzyklopädisch eingestreut, ihre Träger sind der "Mutter Erde" deutlich untergeordnet. Auch wenn es einmal, in Mantra 7 heißt, sie werde von den "niemals schlafenden Göttern" beschützt, ist die Erde aus sich schöpferisch, selbst die Fähigkeit, das Schicksal zu beeinflussen, wird ihr zugesprochen (besonders Mantras 40 und 47). Bei den "früheren Völkern" seien Götter notwendig gewesen, um "die Dämonen" zu überwältigen (Mantra 5). Jetzt aber steht ganz offenkundig "pṛthivī mātā" im Zentrum für die Menschen. Sie wird gar verglichen mit der Göttermutter Aditi in ihrer Funktion für die Menschen (Mantra 61). Und dies kann durchaus als Akt der Emanzipation von überkommenen Göttervorstellungen angesehen werden. Ein paradiesisches Zeitalter verheißt diese "Mutter Erde", der nun "Tribute" gebracht werden (Mantra 62).
Hier begegnet uns eine Weltanschauung, die wenig zu tun hat mit dem, was wir aus den Brahmanas und den Upanishaden kennen. Es geht um Achtsamkeit, weniger um ermächtigende Erkenntnis. Und es scheint die Idee auf, die Welt als das Zuhandene sei zunächst einmal schlicht da, ewig und verlässlich, Götter wie Prajāpati seien nur sekundäre Helfer des Menschen, nicht notwendiger Weltgrund. Den Hinweis auf eine wichtige Parallelstelle in der Rig Veda verdanken wir Mircea Eliade, der in "Die Religionen und das Heilige" aus X, 18 ("Lied zur Beerdigung") Mantra 10 stark verkürzend zitiert: "Neige dich gegen die Erde, deine Mutter! Möge sie dich retten vor dem Nichts!" (Eliade 1954, S. 21).
Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass unter den Verfassern der Texte des Atharvaveda auch Frauen waren, während die jüngeren Texte der Brahmanas und der Upanishaden nach bisherigem Wissensstand ausschließlich von männlichen Angehörigen der beiden obersten Kasten, der Brahmanen/Priester-Gelehrten und der Kshatriyas/Krieger-Politiker, mit jeweiligen spezifischen Kasteninteressen, geschrieben wurden. Im Hymnus an die Erde geht es um ein gelingendes praktisches Leben - nicht wie sonst in der Atharvaveda um magische Rituale und Opfer, und auch nicht um religiöse Spekulation wie in späteren Texten.
Einige Anklänge gibt es zum Aton-Hymnus Echnatons, der am Sonnen-Gott Aton in verschiedenen Wendungen preist, dass er Schöpfer und Erhalter zugleich sei: "Deine Strahlen säugen alle Wiesen;/wenn du aufgehst, leben sie und wachsen um deinetwillen./Du erschaffst die Jahreszeiten, um sich entwickeln zu lassen, was alles du schaffst,/den Winter, sie zu kühlen,/die Hitze, damit sie dich spüren." (Übersetzung von Jan Assmann 1999, S. 221).
Quelle: Klaus Mylius (Hrsg.), Älteste Indische Dichtung und Prosa, Wiesbaden: VMA-Verlag, 1981
Echnatons Sonnengott
Echnaton (18. Dynastie, Neues Reich, 2. Hälfte 14. Jahrhundert vor Christus) wird im populären Verständnis als Begründer des Monotheismus gefeiert. Wissenschaftlich ist sowohl offen, ob er einen stringenden Monotheismus vertrat, als auch, ob er seine monotheistischen Ansätze nicht von anderen übernommen habe. Seine Verfolgung anderer Götter betraf vor allem Amun, andere wurden eher ignoriert. Und monotheistische Konzepte finden sich auch schon in der Rigveda, etwa in 10.121 oder 10.129. Unbezweifelt allerdings kommt Echnaton zu, als erster individuell greifbarer Religionsstifter aufzutreten, auch wenn sein Vater Amenophis III. bereits Vorarbeit geleistet hatte.Der primär mit Aton verbundene Sonnenkult war ein wichtiges Element der altägyptischen Religion. Bei Echnaton wurde er beherrschend - und nach einer verbreiteten Auffassung ging es Echnaton dabei auch darum, den parallelen Amun-Kult und dessen politisch einflussreichen Apologeten zu entmachten. Dem widerspricht allerdings der Ägyptologe Christian Bayer in seiner Ausgabe der beiden Echnaton zugesprochenen Sonnenhymnen von 2007 bei Reclam. Für Bayer war Amun zum einen auch eng mit dem Sonnenkult verbunden, zum anderen konnte die Amun-Priesterschaft als loyal gelten. Während weite Teile der Forschung bei Echnaton primär eine Neuformulierung des altägyptischen Henotheismus erkennen, wurde nach Auffassung von Erik Hornung ("Der Eine und die Vielen", 1971) von Echnaton mit der Verschiebung von Amun zu Aton als oberstem Gott zunächst zwar "nur" eine Dominanz der Lichtgottheiten eingeleitet, in der Zielsetzung sei es Echnaton aber um die Ausschaltung aller anderer Götter neben Aton gegangen, also um einen Monotheismus. Im strengen Unterschied zu den später folgenden monotheistischen Offenbarungsreligionen beruft Echnaton sich jedoch nicht auf eine Intervention Atons, sondern macht sich selbst - im Stil des tradierten Preisgesangs - im "Großen Hymnus an Aton" zum (von seinem höchsten Beamten Eje) zitierten Verkünder und Vermittler der umfassenden Macht Atons. Umfassend allerdings primär für die Belange der Menschen, im Besonderen Ägyptens - allerdings werden auch "Fremdländer" von ihm geschützt. Darüber hinausgehende Horizonte werden nicht angesprochen, auch nicht eine Verpflichtung Aton bzw. seiner Schöpfung gegenüber, wie dies im thematisch durchaus vergleichbar aufgebauten "Hymnus an die Erde" der Atharvaveda geschieht. Psalm 104 im Alten Testament erscheint als eine Umformulierung des Echnatonschen Hymnus, wobei als markantes neues Element hier "die Sünder" erscheinen.

Echnatons Gottesvorstellung ist durch Klarheit und Eindeutigkeit ausgezeichnet. In besonderer Weise eindeutig ist sein Gott auch in der Geschlechtlichkeit: Er ist geschlechtslos. Seine "Gattin" Ma'at verkörpert in den Sonnenhymnen Wahrheit und Gerechtigkeit und bestätigt damit seine Geschlechtslosigkeit. Echnatons Gott ist weder strafend noch fordernd, sondern, durchaus "Mutter Erde" vergleichbar, versorgend und gewährend. Allerdings auch limitierend nach seinen Gesetzen, "Jeder einzelne erhält seine Nahrung und ihre (der Menschen - H.Sch.) Lebenszeit ist gezählt". Hornung sieht die besondere Leistung Echnatons darin, "mythische durch rationale Aussage, mehrwertige Logik durch zweiwertige" ersetzt zu haben (Hornung 1971, S. 241). Aus moderner mythologiekritischer Sicht mag dies so erscheinen, im Vergleich Echnaton-Atharvaveda wird diese Auffassung jedoch problematisch. Echnatons Aton-Mythos reduziert den schier unübersehbaren Vorrat ägyptischer Mythologeme auf den Kern der göttlich-menschlichen Interaktion und (einseitigen) Abhängigkeit. Dies steht quer zur traditionellen Unterscheidung Mythos-Logos. Ich sehe eher eine durch gesellschaftlich gegebene Herrschaftsinteressen instrumentalisierte Mythologie ersetzt durch eine erstaunlich pragmatische Sicht auf das Göttliche als erhaltenden Naturzusammenhang. Leider wissen wir zu wenig über die von Echnaton installierte Verwaltungspraxis um beurteilen zu können, wie weit seine Reformen tatsächlich an pragmatischer Lebensverbesserung interessiert waren - oder nur daran, die eigene Macht absolut zu begründen und zu legitimieren, wie die kritische Sicht auf Echnaton behauptet.
Im etwas später abgefassten sogenannten "Kleinen Hymnus" wird Aton ausdrücklich nicht nur als Schöpfer und Erhalter der Welt, sondern auch als Schöpfer seiner selbst angesprochen.
Sonnenhymnen waren eine eigene Textgattung innerhalb der altägyptischen Lithurgie. Jan Assmann bietet alleine aus der Amarnazeit 7 Beispiele, darunter die beiden Echnaton zugesprochenen, der "Große" und der "Kleine Hymnus". In fast allen von Assmann versammelten Hymnen, wie immer sie auf den alten Sonnengott Re, auf Amun oder Aton oder in einem großen Hymnus auf Ptah bezogen sind, erscheint Gott als Schöpfer und Erhalter der Welt und konkret auch der beiden Länder Ägyptens.
"Die arabische Wüste ist von zerbrochenen Gottesvorstellungen umsäumt." So heißt es im "Buch Franza", dem unvollendet gebliebenen Roman Ingeborg Bachmanns über ein problematisches Geschwisterpaar, das auf einer Ägyptenreise sein Heil sucht. Angesprochen wird bei Bachmann auch wiederholt der Mythos von Isis und Osiris, des göttlichen Geschwisterpaares, das gemeinsam Horus zeugte, der als Schutzgott der Pharaonen galt. Echnaton war gewiss einer der bedeutendsten "Zerbrecher" von Gottesvorstellungen, auch wenn es nach seinem Tod zügig zu einer Restauration der alten Pluralitäten und Komplexitäten kam.
Quellen:
Jan Assmann, Ägyptische Hymnen und Gebete, Universitätsverlag Freiburg Schweiz/Vandenhoeck&Rupprecht Göttingen, 1999
Christian Bayer, Echnaton. Sonnenhymnen, Reclam Verlag, 2007
Lektüreempfehlung: Erik Hornung, Der Eine und die Vielen. Ägyptische Gottesvorstellungen, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971
Abbildung: Echnaton und Nofrete mit drei Töchtern unter Atons Strahlen
Der alttestamentarische Gott
Gibt es überhaupt den einen alttestamentarischen Gott? Für
die einen ist er der strafende, für die anderen der
liebende, beschützende Gott. Das Christentum hat lange einem
liebenden Gott des Neuen Testaments einen grausamen Gott des
Alten Testaments gegenübergestellt. Heute dominiert die
Auffassung eines schon im Alten Testament auch wohlwollenden
Gottes.Ohne Zweifel ist der auf den ersten Blick so klar umrissene alttestamentarische Gott ein vielschichtiger Gott. Dies liegt zum einen daran, dass die biblischen Quellen unterschiedlicher Herkunft sind, von Autorschaft, Entstehungszeit und auch Entstehungsregion her. Zum anderen auch daran, dass dieser Gott ganz unterschiedlichen Personen oder Personengruppen zugewandt ist in Handeln und Sprechen. Davon zu trennen ist zum dritten die situative Differenzierung.
Der Gott, der mit dem Satan über Hiob verhandelt ist ein anderer als der, der sich in der großen Naturschöpfungsrede an Hiob wendet. Mit dem Satan verhandelt ein erstaunlich demütiger Gott, der den Satan keineswegs zurechtweist, sondern sich von diesem zweimal zu einem Deal überreden lässt. Dagegen trumpft der Gott der
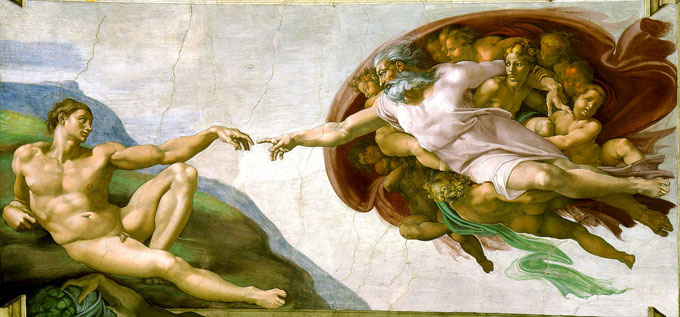 Schöpfungsrede Hiob
gegenüber gewaltig auf. Macht ihm klar, dass es mit der
Gottesebenbildlichkeit nicht so weit her sei, wie die
Menschenperspektive es gerne hätte. Hiob möge sich also
aller Spekulation um den Willen und die Pläne Gottes
enthalten. Doch dann erscheint ein gnädiger Gott, der Hiob
alle seine Verluste erstattet, da Hiob sich gehorsam zeigte.
Schöpfungsrede Hiob
gegenüber gewaltig auf. Macht ihm klar, dass es mit der
Gottesebenbildlichkeit nicht so weit her sei, wie die
Menschenperspektive es gerne hätte. Hiob möge sich also
aller Spekulation um den Willen und die Pläne Gottes
enthalten. Doch dann erscheint ein gnädiger Gott, der Hiob
alle seine Verluste erstattet, da Hiob sich gehorsam zeigte.Ein ganz eigener Gott ist der Gott des Propheten Daniel. Daniel wurde aufgezogen am Hofe Nebukadnezars in "Babylonischer Gefangenschaft". Sein Gott belegt den Gegenüber Nebukadnezar mit Bildern, die zum einen an die Messiaserwartung erinnern, zum anderen an das sumerische Gottkönigtum. Ein Gott nebenbei des Vegetariertums (Dan 1,12). Auch an anderen Stellen des Alten Testamentes, die sich mit Nebukadnezar befassen, steht Gott keineswegs auf der Seite der Israeliten, vielmehr wird verschiedentlich erklärt, Gott habe die Israeliten ihrer Verfehlungen wegen in die Hände Nebukadnezars gegeben (z.B. Esr 5,12). Wobei Verfehlungen vor allem dem letzten König Zedekia vorgeworfen werden, unter anderem sei er eidbrüchig geworden gegenüber Nebukadnezar (2. Chr 36,13). Dass der alttestamentarische Gott wesentlich ein "Kriegsgott" gewesen sei, der auf Seiten der Israeliten eingriff, gilt nur für die "Jahwe-Kriege" der Frühzeit. Der strafende Gott dann ist verbunden mit einer Zeit der Krise des israelischen Königstums.
Angesichts der rational aufzuklärenden Vielfältigkeit des alttestamentarischen Gottesbildes erstaunt es nicht, dass neben dem Judentum auch spätere Religionsgründungen und religiöse Spekulationen wie die des Joachim von Fiore auf ihm bauen konnten. Und es ermöglichte dem Christentum, mit der Trinitätslehre gnostische Spekulationen und anhaltende messianische Erwartungen zu integrieren in dieses Gottesbild.
Gegenüber anderen historisch frühen Gottesbildern, die gleichfalls monotheistisch zu verstehen sind (wie etwa Echnatons Aton oder Zarathustras Ahura Mazda) ist das alttestamentarische ausgezeichnet durch die Analogie zum Menschenbild. Eine Analogie, die strikt zu unterscheiden ist von der Menschenähnlichkeit der Götter etwa im griechischen Pantheon. Sie überträgt nicht menschliche Eigenschaften auf Gott - in der Bibel wird dies immer wieder zurückgewiesen - sondern verpflichtet den Menschen in einer Weise moralisch, die wir sonst erst wieder in der Platonschen Ideenlehre finden. Eine Verpflichtung, deren implizite Überforderung das Christentum abmildert in der Vermittlerfigur Jesu, der Manichäismus radikalisiert in seiner Licht-Erlösungslehre.
Noch wenig beschäftigt hat sich die Deutungsfreude der christlichen Theologie mit dem Umstand, dass die Gottesebenbildlichkeit des Menschen in der Genesis von Luther mit diesem Satz expliziert wird: "Vnd schuff sie ein Menlin vnd Frewlin." Allerdings ist im hebräischen Original nur allgemein von "adam" die Rede, "Mensch", desgleichen in der Septuaginta mit "anthropon". Michelangelo trug dem zumindest insofern Rechnung, als er in Gottes linkem Arm bereits Eva zeigt, die Adam fixiert. Sein Gott bleibt dennoch, zumindest auf den ersten Blick, der väterliche Herr mit rauschendem Bart, androgyne Züge finden wir nicht.
Abbildung: Michelangelo Buonarotti, Deckenfresko der Sixtinischen Kapelle, Erschaffung Adams, 1508
Mithras - Welterhalter im Zeichen des Stieres
Der Mithraskult wurde in besonderer Weise geadelt durch die
häufig zitierte, aber umstrittene Aussage des
Religionswissenschaftlers Ernest Renan in "Marc Aurèle ou la
fin du monde antique" von 1882: " On peut dire que, si le
christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelque
maladie mortelle, le monde eût été mithriaste." (Renan 1882,
S. 390) Der aus einem Stein
zur Wintersonnenwende geborenen Gott prägte nach Auffassung
des kanadischen Kulturhistorikers Richard Foltz ausgehend
vom hattisch-mittanischen Einflussbereich Mitte des 2.
vorchristlichen Jahrtausends bis hinein ins 4.
nachchristliche Jahrhundert den europäischen Raum
maßgeblich. Für manche Forscher ist allerdings noch nicht
ausgemacht, dass es eine Kontinuität vom persischen zum
römischen Mithras gibt. Die römische Mithras-Verehrung fand
ein jähes Ende durch die Erhebung des Christentums zur
römischen Staatsreligion, womit seine Anhänger massiver
Verfolgung ausgesetzt wurden und seine Kultstätten zerstört
oder verschüttet.
Der aus einem Stein
zur Wintersonnenwende geborenen Gott prägte nach Auffassung
des kanadischen Kulturhistorikers Richard Foltz ausgehend
vom hattisch-mittanischen Einflussbereich Mitte des 2.
vorchristlichen Jahrtausends bis hinein ins 4.
nachchristliche Jahrhundert den europäischen Raum
maßgeblich. Für manche Forscher ist allerdings noch nicht
ausgemacht, dass es eine Kontinuität vom persischen zum
römischen Mithras gibt. Die römische Mithras-Verehrung fand
ein jähes Ende durch die Erhebung des Christentums zur
römischen Staatsreligion, womit seine Anhänger massiver
Verfolgung ausgesetzt wurden und seine Kultstätten zerstört
oder verschüttet."Mithra (Skt. Mitra) is one of the principal deities of the early Indo-Iranian pantheon." (Foltz 2013, S. 19). Er erscheint zuerst auf einem Mitanni-Sigel von 1450 vor Christus als Bullentöter. In der Zeit um 1350 vor Christus wird er gemeinsam mit drei anderen Gottheiten (Varuna, Indra, Nasatya) in einem Vertrag zwischen Mitanni- und Hethiter-Regime genannt. In der Achämenidenzeit scheint er die leitende Gottheit gewesen zu sein. In der Partherzeit wurde er mit Strahlenkranz als Sonnengott dargestellt. Als Gottheit des römischen Heeres eroberte er mit phrygischer Mütze nach der Zeitenwende ganz Europa. Im iranischen Raum wurde sein Kult überlagert (ein Relief zur Amtseinführung von Ardashir II. zeigt ihn untergeordnet neben Ahura Mazda) und schließlich verdrängt durch zunächst Zoroastrismus (der Stieropfer ausdrücklich ablehnte), dann Manichäismus.
 Mithras war eng mit einem
Stierkult verbunden, der die jährliche Erneuerung der
Welt/der Sonnenkraft mit der Wintersonnenwende garantieren
sollte. Geboren wurde er in einer Felsengrotte, aus dem
Gestein. In diese Grotte schleppte er den
Weltenstier/Himmelsstier zum Opfer. Wie weit Mithras selbst
auch Tod und Auferstehung unterworfen war, ist umstritten.
Der Bezug von Mithras zur Sonne wurde in der Partherzeit, um
die Zeitenwende, besonders herausgestellt. Seine soziale
Funktion bestand darin, Verträge zu sichern. Vertragsbrecher
wurden von ihm bestraft. Allerdings existieren nur wenige
historische Quellen aus dem iranischen Raum, die
weitergehende Aussagen ermöglichen.
Mithras war eng mit einem
Stierkult verbunden, der die jährliche Erneuerung der
Welt/der Sonnenkraft mit der Wintersonnenwende garantieren
sollte. Geboren wurde er in einer Felsengrotte, aus dem
Gestein. In diese Grotte schleppte er den
Weltenstier/Himmelsstier zum Opfer. Wie weit Mithras selbst
auch Tod und Auferstehung unterworfen war, ist umstritten.
Der Bezug von Mithras zur Sonne wurde in der Partherzeit, um
die Zeitenwende, besonders herausgestellt. Seine soziale
Funktion bestand darin, Verträge zu sichern. Vertragsbrecher
wurden von ihm bestraft. Allerdings existieren nur wenige
historische Quellen aus dem iranischen Raum, die
weitergehende Aussagen ermöglichen. Die römischen Miträen, die ab dem 1. nachchristlichen Jahrhundert datieren, wurden meist unterirdisch oder zumindest eingesenkt in den Boden angelegt. Die Decken waren mit Sternen ausgemalt. Die zentrale Szene der Stiertötung auf dem Mithras-Relief war umrahmt mit Motiven, die Bezüge zur Astronomie haben. Auf dem Relief von Osterburken sehen wir die 12 Tierkreiszeichen in einem Bogen über der Opferszene, mit der Waage in der Mitte. Mithras selbst wird in der Römerzeit durchgängig ohne Strahlenkranz, mit phrygischer Mütze dargestellt. Sol erscheint in der Regel auf den flankierenden Szenen mit Mithras gemeinsam, auf dem Sonnenwagen. Allerdings existieren auch zum römischen Mithraskult wenig mehr als bildliche und architektonische Zeugnisse.
Dies förderte teilweise sehr kühne astronomische Ausdeutungen der erhaltenen Altar-Reliefs, etwa von David Ulansey, der Mithras als Beherrscher der Präzession der Äquinoktien deutet. Weitere Autoren, so Noel Swerdlow und Roger Beck, haben auf die Beziehungen des Mithraskultes zur Astronomie/Astrologie hingewiesen und den Kult in Verbindung vor allem mit den Sternbildern Stier und Skorpion gebracht. Zusammenfassend dargestellt wird das von Joachim Barth in seinem bemerkenswerten Werk "Das Evangelium am Himmel" von 2023, S. 186-194 und S. 622-625.
Im römischen Reich - und vermutlich auch davor - war der Mithraskult Männern vorbehalten. Von daher, aber auch durch seine Verbindung mit Blutopfern und exklusiven Initiationsriten, ist es eher unwahrscheinlich, dass er die Bedeutung des Christentums hätte erreichen können, wie Renan annimmt.
Lektüreempfehlung: Richard Foltz, Religions of Iran. From Prehistory to the Present, London: Oneworld Publications, 2013, S. 19-31
Abbildungen: Geburt des Mithras aus dem Felsen, 2. Hälfte 2. nachchr. Jahrhundert, Mithräum Heidelberg. Mithras-Altar aus Osterburken, Anfang 3. nachchr. Jahrhundert, Badisches Landesmuseum Karlsruhe
Enūma eliš - Als oben der Himmel noch keinen Namen hatte
1875 wurden die ersten Tafeln des babylonischen Schöpfungsberichtes (Enūma eliš - "Als oben" - nach dem Textanfang) von Georg Smith in den Ruinen von Ninive entdeckt. Das Werk erstreckt sich über sieben Tafeln. Wir erfahren allerdings wenig über die Erschaffung der Welt, mehr über die Erschaffung der Götter und die Kriege zwischen den Göttern. Die erste Tafel deutet immerhin die Scheidung von Wasser und Land an und die Erschaffung der Zeit, ansonsten geht es schon hier hauptsächlich um die Götter. Als erstes Götterpaar werden, ungeschaffen, Apsu - erster Erzeuger - und Tiamat - erste Gebärerin - genannt, die mit der Zeugung von Lachmu und Lachamu, dann Ansar und Kisar und weitere zu Anu und Ea/Nudimmud bis hin zu Marduk die Schöpfung initiieren. Es kommt zu ersten Auseinandersetzungen zwischen Apsu, den das Gelärme seiner Nachkommen belästigt und diesen. Dabei wird Apsu von Anu getötet. Die Tafeln Zwei bis Vier schildern die Kämpfe zwischen Tiamat auf der einen Seite, ihren göttlichen Nachkommen auf der anderen. Dabei kommt es in der vierten Tafel zu einem Entscheidungskampf zwischen Marduk als "der Herr" und Tiamat, mit Sturmwinden und einer Meeresflut, die sich vernichtend gegen Tiamat wenden. Am Ende der vierten Tafel steht die Erschaffung von Erde und Himmel aus dem Leichnam Tiamtus durch Marduk. Dann folgt auf der fünften Tafel die Schaffung der Sterne/Sternbilder als Sitze der Götter nach Beendigung der Kämpfe und die Gestaltung der Erdoberfläche durch Marduk. Mit der Schöpfung des Menschen wiederum durch Marduk befasst sich die sechste Tafel. Am Ende der sechsten Tafel und auf der abschließenden siebten Tafel wird die "neue Ordnung" zwischen Menschen- und Götterwelt geschildert und beschworen.Dass es anders als in der Genesis nicht um eine schrittweise Schaffung der Grundelemente unserer Welt geht, um Himmel und Erde, Wasser und Grund, Wind und Feuer, Tiere und Pflanzen, wird bisweilen, auch im Blick auf die ägyptischen Schöpfungsvorstellungen, damit begründet, dass die Götter doch jeweils für bestimmte Bereiche zuständig seien und die Schaffung der Götter zugleich mit die Schaffung ihrer Herrschaftsbereiche bedeutet. Dies ist allerdings im babylonischen Schöpfungsbericht nur ansatzweise zu erkennen, insofern Lachmu und Lachamu mit Materie und Zeit verbunden werden können, Ansar und Kisar mit Himmel und Erde. Allerdings wird auf der vierten Tafel dann explizit die Schaffung von Himmel und Erde durch Marduk verkündet.
Bemerkenswert an diesem Schöpfungsbericht ist auch, dass der Schöpfer der Menschen (Marduk) zunächst einmal den allerersten ungeschaffenen weiblichen Schöpfer der (Götter-)Welt (Tiamat) vernichten muß, ehe er seine Herrschaft aufrichtet, beginnend mit der Schöpfung einer menschliches Leben begründenden Welt. Ähnliches kennen wir aus der griechischen Götterwelt mit ihrer Kette von Vatermorden - während das Christentum anhebt mit der Ermordung des Sohnes. Hinter der Aufwertung Marduks steht für die Forschung der Kampf mesopotamischer Städte um die Vorherrschaft. Marduk ist Stadtgott von Babylon, das unter Hammurāpi (1792-1750 v. Chr.) erheblich an Einfluss im Zweistromland gewinnt. Und der Schöpfungsbericht ist zweifellos in Babylon entstanden, vermutlich allerdings erst unter Nebukadnezar I. (etwa 1125-1103 v. Chr.), denn erst ab dieser Zeit wurde Marduk als König der Götter (šar ilī) bezeichnet. Wesentliche Aufgabe dieses Schöpfungsberichtes - und damit auch seines Gottes Marduk - ist es offenkundig, Babylon als Zentrum der Welt zu legitimieren. Marduk steht für eine deutlich partikular funktionalisierte Gottesvorstellung. Er wird vorgestellt nicht nur als Schöpfer der für die Menschheit relevanten Welt (Überschneidungen mit dem Sintflutbericht sind nicht zu verkennen), sondern auch der Sinnstrukturen des Himmels, als Gott der im Zweistromland ab nun gesellschaftsleitenden Astrologie-Astronomie.
Marduk ist Gott der die Menschen leitenden Sterne, der "oben" dem Himmel seinen Namen gab.
Lektüreempfehlung: Thomas Kämmerer/Kai Metzler (Hrsg.), Das babylonische Weltschöpfungsepos Enūma elîš, Münster: Ugarit-Verlag, 2012
Brahman-Atman: Tattvam asi
Mircea Eliade unterscheidet in "Geschichte der religiösen
Ideen", Band 1, Kapitel 75, vier Typen von Kosmogonien, die
sich in den Veden finden: Befruchtung der Urgewässer,
opferhafte Zerstückelung eines Ur-Riesen, Schöpfung aus
einer das Nichts umfassenden All-Einheit, Scheidung von
Himmel und Erde. Elemente dieser Konzeptionen, abgesehen von
der Zerstückelung eines Ur-Riesen, finden wir auch in der
Schöpfungsgeschichte des Alten Testamentes, der Genesis
wieder. All diese Vorstellungen hintergeht die in einigen
Upanishaden ab etwa 900 vor Christus entwickelte Konzeption
des Brahman, der fortgeschrittenen Gestalt des "tad ekam"
("Das Eine", All-Eines") aus dem Rigveda 10.129 (Nāsadīya
Sūkta, "Schöpfungshymne"), als identisch mit dem Atman, der
Weltseele, als zugleich Ursubstanz und Schöpfung und
Erhaltungsprinzip. Wobei das Atman als Individualseele in
uns meditierend erfahrbar ist und daraus weiters die
Identität von Atman und Brahman.Bereits die Chāndogya Upanishad, eine der ältesten Upanischaden, niedergeschrieben vermutlich im 7. Jahrhundert, in der es zunächst um den kultischen Gesang geht, dann in langen Ausführungen um die Bestimmungen von Brahman und Atman, entwickelt in III 14 die Identität von Brahman und Atman. "Brahman ist alles, was es hier gibt", er sei auch "mein ātman tief in dem Herzensinnern drin", "kleiner als die Feldfrucht-Körner" aber doch auch "breiter als die Erde, weiter als der Raum, der an das Firmament sie bindet" (III 14,1-3). "So ruht mein ātman tief in dem Herzensinnern drin, als brahman allen Seins" (III 14,4). Im "tattvam asi" des 6. Kapitels ("shashtah adhyayah") wird mit den gleichen Worten nur noch vom Atman gesprochen, gipfelnd in der berühmten Formel "sa atma tattvam asi" - "dieses Atman/dieses Selbst/diese Essenz bist Du" (VI 15,3 und VI 16,3). In der vermutlich noch früheren Brhadāranyaka Upanishad wird im 7. Brahmana die Identität von Brahman und Atman nicht aus dem Schöpfungsakt, sondern aus dem Schöpfungserhalt entwickelt. Hier ist der Brahman, von dem nur anonym gesprochen wird, der, "dessen Leib die Erde ist und der diese von innen heraus überwacht" (III 7,3), und er ist identisch mit dem "ātman, dem inneren Überwacher, dem Unsterblichen" (III 7,3). Und er, der nur in der Einleitung direkt Brahman genannt wird, ist das Atman, das unsterbliche Selbst ebenso der Schöpfung, von der Erde bis zu allen Geschöpfen (III 7,3-15), wie des Menschen (III 7,16-23). Anders als in den Rigvedischen Vorstellungen des "tad ekam" ist Brahman in diesen frühen Upanishaden-Texten nicht persönlich gefasst und nicht als abgetrennt von seiner Schöpfung existierend gedacht.
Im Brahmanismus wird die Vereinigung von Brahman und Atman, und damit der Eingang ins Nirwana, durch rituelle Handlungen und Opfergaben vermittelte. Historisch haben sich dabei ganz unterschiedliche Modelle herausgebildet, mit einem breiten Spektrum von Yoga-Praktiken bis hin zu Ablass-ähnlichen Opferritualen. Auch die Vorstellungen des Nirwana selbst differieren erheblich, als Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten tritt es paradiesähnlich entworfen mit endlosem Glück, als leidlose Unsterblichkeit oder als wirkliches Erlöschen (das bedeutet "Nirwana" wörtlich) des Individuellen in Erscheinung - abhängig auch von Einflüssen des Buddhismus.
Grundsätzlich ist festzuhalten: Die Upanishaden entwickeln keine einheitliche Konzeption von Brahman und Atman. In der westlichen Rezeption, geprägt durch den Deutschen Idealismus, lassen sich drei Deutungsstränge unterscheiden: Brahman als der ursprüngliche Geist, der auf dem Weg über das Atman wieder zu sich selbst komme. Brahman als Weltseele, Atman als Individualseele. Brahman als Schöpfungsprinzip, Atman als Erkenntnisprinzip. Für unseren Kontext ist die Vorstellung einer Identität von menschlichem und göttlichem Wesenskern bedeutsam, die verwandt, aber keineswegs identisch ist mit der alttestamentarischen Vorstellung einer Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Die christliche Gottesebenbildlichkeit steht in einem seltsamen Zirkelschluss. Gott ist mit menschlichen Zügen gestaltet und der Mensch sei nach seinem Bilde geschaffen. Konkretisiert wird alttestamentarisch die Ebenbildlichkeit erstaunlicherweise in der Geschlechtlichkeit, "als Mann und Frau erschuf Er sie", und im Auftrag, die Erde als Dominium zu übernehmen bzw. den "Paradiesgarten" im Raum des heutigen Irak zu pflegen und zu bewachen. Gegenüber dieser eher politisch-gesellschaftlich zu lesende Konzeption hat die Brahman-Atman-Identität auch eine philosophische Bedeutsamkeit als bewusstseinstheoretisch-ontologischer Vorschlag.
Quelle: Walter Slaje (Hrsg.), Upanischaden. Arkanum des Veda, Ffm/Leipzig: Insel Verlag, 2009
Hieros Gamos - Die Heilige Hochzeit
Auf der ersten Tafel des babylonischen Schöpfungsberichtes
"Enūma eliš" wird die Vermischung der beiden Wasser, des
Süßwassers der Gottheit Apsu (männlich  gezeichnet, "Säer")
und des Salzwassers der Gottheit Tiamat (weiblich
gezeichnet, "Gebärerin"), als Beginn der Schöpfung genannt.
Apsu und Tiamat gehen der Schöpfung voraus, sie können auch
naturphilosophisch als erste Materien aufgefasst werden. In
der Forschung wird diese Verbindung bisweilen als erstes
Beispiel eines Hieros Gamos angesehen. Der Begriff stammt
allerdings aus Griechenland, auf Belegen aus dem 7.
Jahrhundert vor Christus wurde die theogamische Verbindung
von Hera mit Zeus so benannt, die an verschiedenen Orten,
markant etwa in Athen und auf Samos, rituell begangen wurde.
James Georg Frazer ("The Golden Bough", 1890, XI. und XII.
Kapitel) übertrug die Benennung auf alle sexuellen
Verbindungen im rituellen Kontext, auch wo es um die
Verbindungen von Göttern und Menschen geht, und deutete
diese als Erneuerung von Fruchtbarkeit, primär der
vegetativ-landwirtschaftlichen. Erst seit den 1960er Jahren
wird die durchgängige und unspezifische Deutung dieser
Kulthandlungen als Fruchtbarkeitsritual in Frage gestellt.
gezeichnet, "Säer")
und des Salzwassers der Gottheit Tiamat (weiblich
gezeichnet, "Gebärerin"), als Beginn der Schöpfung genannt.
Apsu und Tiamat gehen der Schöpfung voraus, sie können auch
naturphilosophisch als erste Materien aufgefasst werden. In
der Forschung wird diese Verbindung bisweilen als erstes
Beispiel eines Hieros Gamos angesehen. Der Begriff stammt
allerdings aus Griechenland, auf Belegen aus dem 7.
Jahrhundert vor Christus wurde die theogamische Verbindung
von Hera mit Zeus so benannt, die an verschiedenen Orten,
markant etwa in Athen und auf Samos, rituell begangen wurde.
James Georg Frazer ("The Golden Bough", 1890, XI. und XII.
Kapitel) übertrug die Benennung auf alle sexuellen
Verbindungen im rituellen Kontext, auch wo es um die
Verbindungen von Göttern und Menschen geht, und deutete
diese als Erneuerung von Fruchtbarkeit, primär der
vegetativ-landwirtschaftlichen. Erst seit den 1960er Jahren
wird die durchgängige und unspezifische Deutung dieser
Kulthandlungen als Fruchtbarkeitsritual in Frage gestellt.Im Bedeutungskern von "Hieros Gamos" steht im heutigen populären Gebrauch die Verbindung der Gottheiten von Himmel und Erde, nicht zuletzt transportiert durch die Kunst, etwa Eichendorffs "Mondnacht" ("Es war, als hätt' der Himmel/Die Erde still geküsst"), christliche Predigttexte oder die Esoterik. In den historischen Beispielen sieht die geschlechtliche Zuordnung in der Regel den Himmel als männlich, die Erde als weiblich, etwa bei der Verbindung von Gaia als Erdgöttin und erster Gottheit (geboren aus dem Wasser) mit dem Himmelsgott Uranos, ihrem Sohn, in Griechenland. Auch bei Zeus und Hera kann dies so verstanden werden. Hans Oppermann sieht 1924 den Zeus Panamaros und die Hera Teleia als "das alte kleinasiatische Paar der Götter des Himmels und der Erde". Allerdings gibt es auch gegenteilige Beispiele, so aus Ägypten die Verbindung der weiblichen Himmelsgöttin Nut (ihr Lachen war der Donner, ihr Weinen der Regen) mit dem männlichen Erdgott Geb.
Aphrodite Avagianou hat in ihrer Dissertation "Sacred Marriage in the Rituals of Greek Religion" 1990/91 in einem Forschungsüberblick anschaulich herausgearbeitet, wie inkonsistent die Befundlage und wie breit aufgefächert in der Forschung die Deutungen zur "Heiligen Hochzeit" sind. Ich beschränke mich daher auf die genauere Darstellung der Befunde zu Samos. Samos war ein Zentrum des Hera-Kultes, neben Argos. Das erste Hereion auf Samos wurde im 8. Jahrhundert vor Christus erbaut. Zum Ritual der Hochzeit von Hera und Zeus auf Samos gibt es einen ersten Beleg aus dem Jahr 346 vor Christus. Darin wird beschrieben, wie die Hera-Statue in Brautkleider gehüllt aus dem Tempel an den Fluß Imbrasos getragen wurde zum Brautbad. Belege zum weiteren Fortgang des Rituals exisiteren nicht, lediglich Reliefs aus Ton und Holz aus dem 7. vorchristlichen Jahrhundert, die Hera und Zeus in enger Verbindung zeigen und von Avagianou gedeutet werden als "representations of the consummation of hieros gamos on Samos" (Avangianou 1991, S. 56). Die kleinasiatische Festlandnähe brachte schon im 6. vorchristlichen Jahrhundert enge Kontakte zum Kybele-Kult. Kybele wurde in Griechenland mit Rhea gleichgesetzt, aber in anderen Mythen auch als Tochter des Zeus (dessen Mutter sie als Rhea wäre) gesehen - dokumentiert zuerst bei Hipponax aus Ephesos um 540 vor Christus.
Augustinus in "De civitate dei" zu Beginn des 5. Jahrhunderts über Marcus Terentius Varros Ableitung der Götter aus zwei Teilen der Schöpfung, Himmel und Erde: "Eine Art Wahrscheinlichkeitsschluss führt ihn (...) zur Annahme, der Himmel sei das tätige, die Erde das leidende Prinzip, und so teilt er jenem die männliche, dieser die weibliche Rolle zu, beachtet aber nicht, daß vielmehr der hier tätig ist, der Himmel und Erde geschaffen hat." (De cititate dei - VII, 28)
Lektüreempfehlung: Aphrodite Avagianou, Sacred Marriage in the Rituals of Greek Religion, Bern u.a.: Peter Lang,1991
Abbildung: Zeus und Hera, Relief aus dem Heraion II, Samos, ca. 610 v. Chr.
Ahura Mazda und die Geburt des Bösen aus dem Geist der
Lüge
In der Götterwelt des altpersischen Reiches gab es, in
historisch noch nicht aufgeklärter Verflechtung mit Mithras,
die höchste Gottheit Ahura Mazda/Ohrmazd/Hurmuz und seine
Kreationen Angra Mainyu sowie Spenta Mainyu, zerstörerischer
versus aufbauender Geist. In welchen Kontexten Angra Mainyu,
das negative Prinzip, zu Ahriman/Ahreman als Gegenspieler
Ahura Mazdas wurde, lässt sich den Quellen nur mit hohen
Ungewissheiten entnehmen. Ebensowenig, wie weit Ahreman als
gleichberechtigte, gleichmächtige Gottheit neben Ahura Mazda
ausgestaltet wurde. In der Forschung gilt das mit
Zarathustras Name verbundene System überwiegend als
dualistischer Entwurf neben dem alttestamentarischen
Monismus. Neben einem Monismus, der auch den Satan kennt und
dieDsen ganz ähnlich zeichnet, wie Ahreman gezeichnet wird,
als Betrüger, der die Menschen verführt.Allerdings ist der Religionswissenschaftler und Privatgelehrte Harald Strohm der Auffassung, Ahura Mazda repräsentiere die früheste Form des ausgebildeten Monotheismus, inspiriert durch die altindische Gottheit Asura Varuna, die, so Strohm im Anschluss an den Iranisten Helmut Humbach, wohl nur in religiösen Eliten eine Rolle spielte und vom Brahmanentum "wegtherapiert" worden sei. Erinnert sei allerdings auch an die Auffassung von Jan Assmann, vorgestellt in seiner Monografie von 2010 "Die Mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus", wonach mit dem Monotheismus die Verteufelung anderer Götter und damit religiöse Intoleranz verbunden seien. Mit dem Monotheismus sei nach Assmann auch die strikte Unterscheidung in religiöse Wahrheit und Lüge in die Kulturgeschichte eingetreten.
Zarathustra wurde nach verbreiteter Auffassung 618 vor Christus geboren. Einige Quellen sehen ihn allerdings wesentlich älter. Helmut Humbach schreibt 1994 in der Einführung zu "The Heritage of Zarathushtra": "According to Xanthos (...), Spitama Zarathushtra (...) lived 600 years before Xerxes' crossing of the Hellespond (480+600=1080 B.C.). This is in approximate agreement with the linguistic evidence." (Humbach 1994, S. 11). Der Religionswissenschaftler Michael Strausberg dagegen vertritt in "Zarathustra und seine Religion" 2005 die Auffassung, man müsse bei Xanthos 6000 v.Chr. statt 600 v.Chr. lesen und schreibt weiter: "Selbst wenn man 600 statt 6000 Jahre liest, weist das genannte Datum einerseits über den Zeitraum historisch verlässlicher Information hinaus und klingt andererseits sehr nach Weltalterkonstrukten" (Strausberg 2018, S. 22).
Wir können offenkundig nichts Gewisses zur Lebenszeit Zarathustras sagen, was primär auf die unsichere Quellenlage und die weit zurückreichenden Traditionslinien der altpersischen Religiosität zurückzuführen ist. Eine der zahlreichen Legenden zum Leben Zarathustras berichtet, er habe bei seiner Geburt gelacht - was zu einem geläufigen Motiv der Zarathustra-Ikonographie wurde und sich auch bei Friedrich Nietzsche in "Also sprach Zarathustra" findet. Ausgegangen wird davon, dass Zarathustra als Erwachsener zunächst Priester des iranischen Gottes Ahura Mazda, des "Mazdaismus" war. Er trat jedoch bald mit einer eigenständigen Lehre auf, die von der Orthodoxie angegriffen wurde. Er starb nach bisherigem Überlieferungsstand eines gewaltsamen Todes.
Die genaueste Auskunft zur Lehre Zarathustras finden wir in den fünf "Gathas", liturgischen Texten, deren überlieferte Form erst im 7. Jahrhundert niedergeschrieben wurde, die inhaltlich und im Sprachstand allerdings überwiegend auf auf das vierte Jahrhundert vor Christus und weiter zurück verweisen: Ahunavaitī, Ushtavaitī, Spenta-mainyu, Vohukhshathra und Vahishtoishti Gatha. Die Gathas bestehen aus einzelnen Yasnas (Y.), "Ritualen", die wiederum in Hâts (Abschnitte, Kapitel) gegliedert sind. Auch die ganze Sammlung liturgischer Texte, in welcher die Gathas überliefert sind, wird als "Yasna" bezeichnet oder als "Avesta", wovon die Sprache, in der diese Texte (in zumindest zwei historisch unterschiedenen Sprachstufen) verfasst sind, ihren Namen bekam.
Die Bilderwelt der Gathas ist stark durch die Viehzucht geprägt, die (zu Zarathustra oder durch ihn) Sprechenden sind häufig Hirten, die sich sorgen um die Zerstörung und den Diebstahl ihrer Herden durch Menschen, welche vom Bösen angeleitet werden. Im Zentrum steht die durchaus als "heilig" zu verstehende Kuh, die sich auch direkt an Zarathustra wendet. In der Forschung wird noch gestritten darüber, ob wir hier und in anderen Parallelen zum Hinduismus einen Hinweis auf eine gemeinsame indoeuropäische Urreligion sehen können, die dem Hinduismus ebenso vorausging wie dem Zoroasthrismus. Oder ob der Zoroastrismus eher als eine spätere Abspaltung vom Hinduismus oder doch zumindest als von diesem stark beeinflusst aufzufassen sei.
Der Name Zarathustras erscheint in den Gathas häufig, an zwei Stelle in der zweiten Gatha (Y. 43,8 und Y. 43,16) spricht er gar in der ersten Person von sich, im Zwiegespräch mit Ahura Mazda, an weiteren Stellen spricht er indirekt von sich, nämlich in der dritten Gatha (Y. 49,12 und Y. 50,6) und in der vierten Gatha (Y. 51,11). In der ersten Gatha wird Zarathustra in dritter Person genannt (Y. 28,6, Y. 29,8, Y. 33,14), ebenso in der zweiten Gatha (Y. 46,13 und 46,19), in der vierten Gatha (Y. 51,12) und in der fünften (Y. 53,1ff - hier geht es um die Familie Zarathustras und die Nachfolge). Dazu erscheint sein Name in der zweiten Person in der zweiten Gatha (Y. 46,14). Wobei es sich an fast allen Stellen ohne Ich-Bezug auch um stilistisch geformte Selbstanreden handeln könnte. In der religiösen Rezeption wurden die Gathas in der Regel als Texte angesehen, die auf Zarathustra selbst zurückgehen. Die Forschung schließt sich dem nicht an.
 Zentraler
Ansprechpartner in den Gathas ist Ahura Mazda ("der Weise
Meister" oder "Meister Weisheit" - Strausberg 2018, S. 8).
Ahura Mazda bündelt sechs Kräfte, Amesa Spentas,
Unsterbliche Heilige/Weise. Die beiden wichtigsten, in den
Gathas auch am häufigsten genannten sind Wahrhaftigkeit und
Gutes Denken. Diesen folgen in der Bedeutung Herrschaft und
Fügsamkeit. Das geringste Gewicht wird in den Gathas
Heilsein und Nichtsterben zugeteilt. In der Regel werden
diese Kräfte/Heilige/Weise auch paarweise genannt. (Vgl.
Erwin Wolff "Die Zeitfolge der Gathas", in: Herman Lommel,
Die Gathas des Zarathustra, 1971, S. 190.)
Zentraler
Ansprechpartner in den Gathas ist Ahura Mazda ("der Weise
Meister" oder "Meister Weisheit" - Strausberg 2018, S. 8).
Ahura Mazda bündelt sechs Kräfte, Amesa Spentas,
Unsterbliche Heilige/Weise. Die beiden wichtigsten, in den
Gathas auch am häufigsten genannten sind Wahrhaftigkeit und
Gutes Denken. Diesen folgen in der Bedeutung Herrschaft und
Fügsamkeit. Das geringste Gewicht wird in den Gathas
Heilsein und Nichtsterben zugeteilt. In der Regel werden
diese Kräfte/Heilige/Weise auch paarweise genannt. (Vgl.
Erwin Wolff "Die Zeitfolge der Gathas", in: Herman Lommel,
Die Gathas des Zarathustra, 1971, S. 190.)In den Gathas finden wir keinen expliziten Gegenspieler Ahura Mazdas, allerdings die beiden "Geister" ("Mainyus"), den "heiligen" ("spenta") und den "betrügerischen" (der hier noch nicht "angra", "zerstörerisch", genannt wird) als anfängliche Schöpfungen Ahura Mazdas. In der Yasna 30 und der Yasna 47 wird deren Zwillingscharakter genauer ausgeführt, auch mit den Kategorien "gut" und "böse" (Y. 30,3). Der betrügerische Geist wird in den Gathas gestaltet als ein Prinzip, das mit Ahura Mazda um den Vorrang über die Menschenseelen streitet, ihm allerdings deutlich untergeordnet ist. Ahura Mazda wird nicht, wie wir dies beim biblischen Gott finden, um Beistand dem "Bösen" gegenüber gebeten, sondern es wird ihm versichert, dass die Sprechenden/Anhänger seiner Religion sich gemeinsam mit ihm dem üblen Geist widersetzen (Y. 35,3ff). Das ist ein äußerst bemerkenswerter Zug dieses Gottes: Dass die Menschen gleichsam seine Verbündeten sind, nicht in erster Linie Bittsteller und auf Gedeih und Verderb ausgelieferte Abhängige. Wobei als der engste Verbündete Zarathustra erscheint (Y. 43,8). Ahura Mazda lebt und gedeiht durch seine Verehrung (Y. 36,5). Mehr noch: Ahura Mazda ist (auch) ein "werdender Gott": "By that spirit by which one upholds best thought you still grow, O Mazda Ahura" (Y. 31,7).
Der betrügerische Geist wird als "betrügerischer Einer" immer wieder Ahura Mazda selbst als "wahrhaftigem Einem" gegenübergestellt. Wobei mit beiden Ausdrücken auch menschliche Individuen gemeint sein können (zumindest den mir zugänglichen Übersetzungen zufolge) - dies dann auch im Plural (z.B. Y. 40,3 und Y. 31,20). Bemerkenswert am Gegenspieler ist, dass er nicht direkt an der Schöpfung beteiligt ist (vgl. Y. 45,7). Spätere mittelpersische Texte machen explizit deutlich, dass Ahreman und seine Abkömmlinge keine materielle Existenz haben, vielmehr darauf angewiesen sind, auf die materielle Welt indirekt einzuwirken über Menschen, die in ihren Bann geraten. Die Menschen selbst gehören zwei von Ahura Mazda regierten Welten an, der materiellen und der geistigen - die einander ergänzen (Y. 28,2; Y. 35,3; Y. 41,6). Die Gathas liefern nicht die geringste Grundlage für eine Unterscheidung nach materiell=böse, geistig=gut, wie sie dann der Manichaismus entwickelte. Der Weg vom betrügerischen Geist zu Ahreman liegt im geschichtlichen Dunkel.
Wie es scheint, ist die religiöse Postulation des Bösen gebunden an die Ausformung monotheistischer Glaubenssysteme. Lediglich bei Echnaton finden wir darauf keine Hinweise. Judentum und Zoroastrismus jedoch haben gemeinsam, dass mit der Formierung eines einzigen Gottes auch "das Böse" Gestalt gewinnt - dann allerdings erst in späteren Entwicklungen zu einem personifizierten umfassenden Bösen wird. Rudolf Steiner hat dies als Erster wahrgenommen und in seiner Anthroposophie Anleihen bei beiden gemacht, indem er sowohl Luzifer als auch Ahriman aufnahm in seine Lehre - in freilich eigenwilliger Gestaltung.
Ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen dem Bösen in der Bibel und dem Bösen bei Zarathustra liegt darin, dass das biblische Böse, der biblische Versucher die Menschheit als Ganzes verführt und damit die Erbschuld begründet. Bei Zarathustra gerät jeder persönlich in die Versuchung, lädt jeder individuell Schuld auf sich - oder eben nicht. Und jeder individuell kann mit Unterstützung durch die guten Kräfte Ahura Mazdas durch eigene Entscheidung seine Schuld korrigieren, sich zum Guten wenden. Dazu braucht es keinen Messias, keinen Erlöser. Insofern ist die These von Foltz im Vorwort zu "Religions of Iran" mit einem Fragezeichen zu versehen: "Monotheisms are notoriously exclusive and intolerant." (Foltz 2013, S. XIII). In den Gathas gibt es dazu keine Belege. Dagegen zahlreiche Stellen, die Toleranz, Offenheit und Gleichberechtigung aller Menschen (unabhängig von der Herkunft, unabhängig vom Geschlecht - s. Y. 39,2) propagieren.
Lektüreempfehlungen:
Gustav Roskoff, Die Geschichte des Teufels, 1987 (zuerst 1869)
Michael Strausberg, Zarathustra und seine Religion, 2018 (dritte, durchgesehene Auflage; zuerst 2005)
Harald Strohm, Die Geburt des Monotheismus im Alten Iran. Ahura Mazda und sein Prophet Zarathustra, München: Wilhelm Fink, 2014
Abbildung: Ahura Mazda, Persepolis, 5. Jahrhundert vor Christus.
Buddha
Siddhartha Gautama (Sanskrit)/Gotama (Pali) lebte nach der "korrigierten langen Chronologie" der Buddhismus-Forschung 563-483, nach neueren Berechnungen 450-370 v. Chr.. Er wurde als Sohn des Fürsten Shudhodana ("der reinen Reis züchtet") aus der Sippe der Shakya im heutigen Nepal geboren, in Lumbini bei Kapilavastu. Der Beiname "Buddha" bedeutet "der Erwachte" und wurde ihm als erstem gegeben, dann aber auch auf eine Reihe von Vorgängern und Nachfolgern übertragen. Ein weiterer Beiname war Shakyamuni - der Weise aus dem Shakya-Geschlecht. Gautamas Vater war im heutigen Sinne vermutlich eher ein wohlhabender Gutsherr und Gouverneur, nicht, wie die Überlieferung möchte, ein "prächtiger König", der den Sohn zum "Weltenherrscher" machen wollte. Sein Reich mit Kapilavastu als Hauptstadt war von Begehrlichkeiten mächtiger Nachbarn bedroht. Vor allem von der südwestlich gelegenen Koshala-Monarchie, der die Shakya tributpflichtig waren. Koshala gehörte zum Einflußbereich des Brahmanentums, während das kleine Reisbauern-Reich der Shakya religiös von Naturverehrung und asketischen Wandermönchen geprägt war.Die Ehe der Eltern Gautamas blieb 20 Jahre kinderlos, bis der späte Sohn geboren wurde. Seine Mutter starb wenige Tage nach der Geburt, ihre Schwester trat an ihre Stelle. Im Alter von 16 Jahren wurde Gautama mit einer Cousine verheiratet. Mit 29 bekam er einen Sohn, den er Rahula nannte, was er später einmal als "Fessel" explizierte. Im gleichen Jahr unternahm er der Legende zufolge die berühmten vier "Ausfahrten" aus dem Palast der Familie, bei denen ihm zunächst Alter, Krankheit und Tod begegneten, was ihn, der bislang abgeschirmt von den Unbilden des Lebens aufgewachsen war, tief erschütterte. Die vierte Ausfahrt führte ihn mit einem asketischen Wandermönch zusammen, dessen Leben er als vorbildlich ansah, um die existentiellen Lebensbedrohungen nicht mehr fürchten zu müssen. Woraufhin er die Familie verließ, um ein Leben als Wanderprediger zu führen. Wanderprediger/Bettelmönche waren im damaligen Indien äußerst angesehen. Es gibt in den Lehrschriften, die ich nach der Ausgabe von Mylius hier zitiere als "Nummer Korb.Nummer Abteilung.Name", das Lehrgespräch über den Lohn des Bettelmönchdaseins (1.1.Sāmaññaphala-Sutta). Darin lässt der Buddha seinen Gesprächspartner, den Magadha-König Ajātasattu, ausführen, was ein Bettelmönch zu erwarten habe bei ihm: "Vielmehr würden wir ihn begrüßen, uns vor ihm erheben, ihn zum Sitzen einladen, ihm Kleidung, eine (gefüllte) Almosenschale, eine Lagerstatt und im Krankheitsfall medizinische Behandlung anbieten" (zit.n. Mylius 1983/98, S. 81).
Im Alter von etwa 35 Jahren erreichte Siddhartha der Überlieferung zufolge unter einem Pappelfeigenbaum/Bodhi-Baum sein Erwachen. Darauf erhielt er den von ihm selbst auch beanspruchten Beinamen "Buddha" ("der Erwachte"), häufig wird er auch angesproche als "Baghavan" ("der Erhabene"). Bald umgab ihn eine große Mönchsgemeinde. Zur Zeit des Gespräches mit Ajātasattu sollen es 1350 gewesen sein!
Auf den ersten Blick und besonders im Blick auf die westliche Rezeption erscheint der Buddhismus als Religion einer saturierten Gesellschaftsschicht, die schon ausreichend mit materiellen Güter versehen ist und nun auch noch die Befreiung von Alter, Krankheit und Tod begehrt. Siddharthas erste Predigt nach dem Erwachen bei Benares, vor fünf Anhängern/Mönchen, leitete er der Überlieferung zufolge mit den Worten ein "Öffnet euer Ohr, ihr Mönche: Die Erlösung vom Tode ist gefunden." (zit. n. Michaels 2011, S. 21). Doch er erreichte als Wanderprediger auch die einfachen Leute, so die Überzeugung des Religionswissenschaftlers Axel Michaels: "Er sorgte sich um das 'Seelenheil' aller, weitgehend unabhängig von ihrem sozialen Stand, ihrer Herkunft, ihren rituellen Verpflichtungen und ihren ökonomischen Möglichkeiten." (Michaels 2011, S. 25). Aus den tradierten kanonischen Texten ist allerdings nicht zu erschließen, was er dem einfachen Volk gesagt haben mag. Seine Lehrreden wenden sich an Mönche und an Vertreter der Führungsschicht. Als besondere historische Leistung des Buddha sieht Michaels die Abkehr von der brahmanischen Praxis, Seelenheil auch von Opfergaben abhängig zu machen: "Seine Lehren erschütterten den jahrhundertealten vedischen Opferritualismus der Brahmanen" (Michaels 2011, S. 25). Dies könnte seine Popularität mit begründet haben, waren die Opferrituale doch häufig sehr kostspielig.
Grundsätzlich ist davor zu warnen, allzu unbefangen von "dem Buddhismus" zu reden, da keine höchste Lehrautorität, keine verbindliche Auslegungspraxis und keine dogmatischen Kontrollinstanzen etabliert wurden - auch wenn es Versuche dazu gab, etwa im "Konzil von Rājagaha" nach Buddhas Tod. Der Buddhismus differiert erheblich nach Schulen, Regionen und historischen Epochen. Michaels vertritt gar die Auffassung, erst der Historismus habe "analog zum Christentum den Buddha als Religionsstifter und den Buddhismus als Religion" konstruiert (Michaels 2011, S. 13). Überspitzt formuliert lässt sich sagen, es gebe zwar Buddhisten, aber keinen Buddhismus. Strittig ist auch nach wie vor, ob der Buddhismus als Religion oder als Philosophie aufzufassen sei (vgl. Mylius 1983/1998, S. 39). Der Buddha selbst bezeichnete seine Lehre als "mittleren Weg" zwischen der, modern ausgedrückt, Orientierung am Lustprinzip und der Selbstkasteiung. Was schon deutlich macht, dass es ihm wesentlich um eine Weise der Lebensführung ging. Dies trug entscheidend dazu bei, seine Lehre bis in die Gegenwart hinein populär zu halten.
Gegenstand bereits der berühmten ersten Predigt (1.3.Dhammacakkappavattana-Sutta - nachzulesen in Mylius 1983/1998 auf den Seiten 242 bis 246) sind die sogenannten "Vier edlen Wahrheiten". Deren erste lautet "Alles ist Leiden". Als Ursprung des Leidens wird zweitens der "Durst" ("tanhā), das Begehren ausgemacht. Begehren, Durst, Trieb - womit man "tanhā" übersetzen kann - erscheinen negativ beim Buddha dreifach, als Liebesdurst/Sexualität, Seinsdurst/Lebenswillen und Wohlstandsdurst/Besitzstreben. Das Begehren kann aufgeklärt werden durch die Einsicht in den Illusionscharakter der realen Welt und umgelenkt auf das Nirwana, so die dritte Wahrheit. Die vierte Wahrheit lässt sich paraphrasieren als "Du musst dein Leben ändern" und umfasst den "Achtfachen Pfad" der buddhistischen Ethik zur Erlösung ("moksa"), mit der Forderung nach rechter Anschauung/Einsicht (in Pali, der Sprache buddhistischen Schriftguts: samma ditthi), rechtem Denken/Entscheiden (samma sankappa), rechtem Sprechen/Reden (samma vaca), rechtem Handeln/Tun (samma kammanta), rechter Lebensführung (samma ajiva), rechtem Bemühen/Streben (samma vayama), rechter Besinnung/Wachheit (samma satti) und rechter Konzentration/Versenkung (samma sammadhi). Kern der Lehre des Buddha ist die Arbeit an der Aufhebung des (letztlich kosmischen) Lebenswillens, den er als Ursache allen Werdens (einschließlich der Wiedergeburt) und damit auch allen Leidens ansah. Verbunden ist in eigentümlicher Gegenspannung zu den - aus westlicher Sicht - eskapistischen Zügen im Leben und in der Lehre des Buddha auch die Zuwendung zu weltlichem Leid, um dieses zu mildern. Insbesondere im späteren Mahāyāna-Buddhismus, der sich um die christliche Zeitenwende herausbildete, wird das so dargestellt.
Zentrale Konzepte des Buddhismus sind, wie auch im Hinduismus, Wiedergeburt (Punabbhava, im Hinduismus Punarājāti), Karman und Nirwana. Die erste Predigt des Buddha trägt in der Überlieferung den Titel "Drehen des Dharmarads“ ("Dharmachakra Pravartana"). Dharma bedeutet Lehre, Regel, Ordnung, Gesetz, Ethik. Analog zum Rad/Kreislauf der Wiedergeburten (Samsāra) setzt das Befolgen der Lehre eine Bewegung in Gang, die nun das Samsara aufzuheben vermag. Das Karman gleichsam als Antriebsenergie des Samsara kann im Verstehen und Befolgen der Lehre positiv beeinflusst werden und zur Erlösung (Moksha) führen, die den Übergang ins Nirwana bedeutet. Eine klare Abgrenzung der beiden Begriffe Moksha und Nirwana ist schwierig, da es (ausgehend von unterschiedlichen Auffassungen im Hinduismus) hierzu erheblich differierende Schulauffassungen gibt. In entscheidender Abkehr vom Hinduismus sind die Grundlagen für das Erreichen der Erlösung und das Eingehen in das Nirwana im Buddhismus individuelle Erfahrung und ethisches Verhalten, nicht durch Priester vermittelte Offenbarung und Opfergaben. Insbesondere wendete der historische Buddha sich entschieden gegen Tieropfer. Bemerkenswert ist auch die religiöse Verwendung des Sanskrit-Begriffes "Maya", der im allgemeinen Sprachgebrauch Illusion, Zauber, Schönheit, Kreativität bedeuten konnte. Während er im Hinduismus neben "Illusionswelt" auch kosmische Schöpferkraft (weiblich gedacht) bezeichnen kann, ist er im Buddhismus nur negativ belegt. Dass die Mutter des Buddha der Legende zufolge "Maya" hieß, wird landläufig mit ihrer besonderen Schönheit erklärt. Angesichts der positivistischen Züge in der Lehre des Buddha stellt sich die Frage, ob wir seine "Maya" nicht auch in Analogie zu einem konstruktivistischen Weltverständnis lesen müssen. Der Soziologe Werner Vogd hat hierzu 2014 in seiner Publikation "Welten ohne Grund" interessante Überlegungen vorgetragen.
Gautama hat sich nach der Überlieferung selbst nie als Gott oder auch nur als in besonderer Weise mit dem Numinosen Verbundener gesehen, sondern lediglich als Überbringer einer Lehre ("dharma"). Und diese Lehre wurde ihm nicht, wie es zuvor und in der Folge bei Religionsgründern üblich war, durch ein höheres Wesen, im jüdisch-christlichen Kontext als "Gott" bezeichnet, offenbart. Dass er indes im Mahāyāna (im "Großen Fahrzeug/Weg", der Ausprägung des Buddhismus, die um die christliche Zeitenwende entstand) in die Transzendenz entrückt wurde durch seine Anhänger verweist auf ein Desiderat, das Desiderat eines Gottes für alle, nachdem die Brahmanen-Kaste in Indien das Numinose zu einer spekulativen Entität gemacht hatte, zugänglich nur Eingeweihten. Strukturelle Analogien zur Wende des Protestantismus gegen die Praxis des westlichen Christentums sind erkennbar, allerdings verbieten sich rasche Kurzschlüsse. Alleine schon, weil keine der höheren hinduistischen Gottheiten oder andere Gottesvorstellungen im Buddhismus eine Rolle spielen, auch wenn der Buddha des Mahāyāna starke Ähnlichkeiten mit der Christus-Figur zeigt. Die Boddhisattvas des Mahāyāna sind am ehesten christlichen Heiligen vergleichbar, Wesen einer höheren karmischen Entwicklungsstufe. Und wenn in buddhistischen Texten von Göttern oder Teufeln die Rede ist, sollte dies nicht aus theistischer Sicht verstanden werden. Das macht eine Passage zum Ende der ersten Rede des Buddha deutlich: "Durch den Erhabenen ist (...) das höchste Rad der Lehre in Bewegung gesetzt worden; zurückzurollen ist es weder durch einen Gott und durch keinen Teufel, nicht durch Brahma noch durch irgend jemand in der Welt." - 1.3.Dhammacakkappavattana-Sutta - zit.n. Mylius 1983/1998, S. 245. Allerdings differieren auch hier die unterschiedlichen Schulen und regionalen Ausprägungen des Buddhismus erheblich.
Es scheint auch zu einer Art der Konkurrenzbeziehung zwischen Hinduismus und Buddhismus gekommen zu sein mit Blick auf die Attraktivität der jeweiligen Vorstellung vom Nirwana. Der Buddha selbst sah im Brahmanentum allerdings keine ernstzunehmende Konkurrenz, so bezeichnete er im Lehrgespräch über die Kenner der drei Veden (1.1.Tevijja-Sutta) ihre Lehre von der Verbindung mit Brahma als Eintritt ins Nirwana unverblühmt als "töricht". In einer beispielhaften positivistischen Argumentation setzt er auseinander, dass die Rede vom Brahma nichtig sei, da es keine Erfahrung des Brahma gebe. "Wenn die die drei Veden kennenden Brahmanen zu einer Gemeinschaft mit jemand, den sie nicht kennen, den sie nicht sehen, den Weg zeigen wollen, (... "aus dem Kreislauf der Wiedergeburten" ...) so ist dieser Standpunkt nicht annehmbar." (zit.n. Mylius 1983/98, S. 117). In seiner Argumentation verfolgt der Buddha (und dies nicht nur hier) übrigens eine Strategie, die große Ähnlichkeit mit der Mäeutik/Hebammenkunst des Sokrates aufweist, die etwa zeitgleich entstanden ist.
Auffallend an der ursprünglichen Lehre des Buddha ist die letztlich negative Wertung der menschlichen Existenz als permanentes Leiden, dem nur durch Aufgeben des Lebenswillens zu begegnen sei. Allerdings hat der Buddha sich entschieden gegen Selbsttörung ausgesprochen! Auch Kasteiung hat er abgelehnt. Die Themenkreise Frauen, Sexualität und Geburt sind in seiner Lehre aus heutiger Sicht jedoch hoch problematisch abgehandelt. Frauen neigen danach zur Untreue, Sexualität blockiert den Weg zur Erlösung und Geburt wird nur umgewertet positiv gesehen als Selbstgeburt des Erleuchteten. Vor dem Hintergrund, dass sein eigener Vater erst 20 Jahre nach der Heirat ein Kind bekam und Siddhartha selbst erst 13 Jahre nach der Heirat, dass weiters die Mutter bald nach der Geburt starb und deren Schwester, Zweitfrau des Vaters und vermutlich Mutter seiner beiden Halbgeschwister, ihre Rolle übernahm, kann über psychologische Motivationen spekuliert werden. Zum Verständnis der Lehre und ihrer historischen sowie strukturellen Einordnung ist dies allerdings ohne Belang.
Ich sehe den Beitrag des Buddhismus zum Thema "Gottesvorstellungen" vor allem darin, ein religiöses Modell anzubieten, ohne auf eine Gottesvorstellung zu rekurrieren - im Unterschied aber zur Philosophie an einem integrativen Transzendenzbezug festzuhalten in der Konzeption des "Nirwana". Während sich im östlichen Mittelmeerraum der Monotheismus ausbreitet, unternimmt es Gautama, den Ansatz aller Gottesvorstellungen, den Schöpfungsursprung, in Frage zu stellen. Vergleichbares ereignet sich etwa zeitgleich im Daoismus, dort aber als Bejahung des Kreislaufes von Werden und Vergehen. Dass der Buddha selbst dann zu einer Gottheit gemacht wurde, war sicherlich für die Entwicklung des Buddhismus zur Weltreligion von Bedeutung, spielt in meinem Kontext aber keine Rolle.
Lektüreempfehlungen:
Klaus Mylius, Die vier edlen Wahrheiten. Texte des ursprünglichen Buddhismus, Ditzingen: Reclam, 1983/1998
Axel Michaels, Buddha. Leben, Lehre, Legende, München: C. H. Beck, 2011
Jesus Christus
Die Christus-Vorstellung besteht im Kern aus drei (schon im
Alten Testament zu findenden) Komponenten, die sich fassen
lassen als "Nullstellung", "Bejahung" und "Utopie", analog
zur Trias "Glaube, Liebe, Hoffnung" (umgestellt nach 1.
Korinther 13.13). Die "Nullstellung" (keineswegs zu
verwechseln mit einem modernistischen "Reset") impliziert
die Möglichkeit eines radikalen Neuanfangs, der selbst die
"Erbsünde" aufzuheben vermag in einem Glaubensakt, der von
individueller wie kollektiver Vergangenheit absieht. Dieser
Glaubensakt bedarf einer Verstetigung durch die Bindung an
ein Prinzip, das alles Gegenwärtige zunächst einmal
vorbehaltlos bejaht und jede Fortsetzung vergangener
Auseinandersetzungen und Konkurrenzen aussetzt in einem
permanenten Akt von Selbst- und Fremdbejahung ("liebe deinen
Nächsten wie dich selbst"). Und schließlich wird jedem
vergleichenden Zweifel begegnet durch die Blickwendung nach
vorne, sei es in diesseitiger Erfüllung in der Nachfolge
Christi, sei es durch die Erwartung von Wiederkunft, Gericht
und Auferstehung.Hier soll, im Anschluss an zuerst von Friedrich Schleiermacher vorgetragene Auffassungen, das in Jesus Christus gefasste Konzept abseits aller Trinitätsdiskurse gelesen werden als ein für sich stehendes Gottesbild. Die Untersuchung gilt dabei vor allem vier Aspekten des Jesus Christus: Verletzlichkeit, Humanismus, Leiblichkeit und Individualismus. Diese Aspekte sind eng korreliert, insofern natürlich die Leiblichkeit auch Verletzlichkeit mit sich bringt und dieses Gottesbild in besonderer Weise - über den Leib als menschlichen - mit den Anliegen der Menschheit und den Grundlegungen des Humanismus als Weltanschauung, die auf Individualität basiert, verbindet.
Die für mich erstaunlichste Leistung des Christentums ist es, abzurücken von dem vorgängigen alttestamentarischen, substantiell nicht affizierbaren Gott hin zu einem Gott, der dem Zyklus von Werden und Vergehen unterworfen ist, der verletzlich ist, der hingerichtet werden kann und leiden. Auch wenn dies nur ein Aspekt ist, der im theologischen Gesamtgebäude aufgehoben wird in der Trinität und in der Auferstehung scheinbar negiert: Hier zeigt sich ein Ansatz, der für die Erfolgsgeschichte des Christentums in der Neuzeit von entscheidender Bedeutung wurde und sein Überleben auch unter dem Ansturm der Theodizee-Frage sicherte, die seit dem Erdbeben von Lissabon mit dem Einsturz vollbesetzter Kirchen an Allerheiligen 1755 nicht mehr verstummt ist. Ein Gott, der selbst leidet, verliert seine Glaubwürdigkeit nicht, wenn er Leiden Unschuldiger zulässt. Dietrich Bonhoeffer hat sich diesem Thema während seiner Haftzeit intensiv gewidmet, dokumentiert ist dies in der Sammlung "Widerstand und Ergebung", unter anderem mit einem der bemerkenswertesten Sätze: "Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes; nur der leidende Gott kann helfen."
Der evangelische Theologe Ingo Baldermann hat sich dem Thema des "leidenden Gottes" zeitlebens gewidmet. Er vertritt gar die Auffassung, dass auch das Alte Testament in der hebräischen Urform keinen allmächtigen, dem Leiden enthobenen Gott kenne. Darüber mögen die Theologen sich streiten. Fakt ist, dass das Bild vom allmächtigen Vater-Gott zu einem der wirkmächtigsten in der Kulturgeschichte wurde und dass es mit dem Alten Testament verbunden wird, während der leidende Gott dem Neuen Testament zugeordnet wird.
Der verletzliche, leidensfähige Gott ist zum Mitleiden befähigt. Und auch wenn Bertrand Russell sich in „Warum ich kein Christ bin“ viel Mühe gibt nachzuweisen, wie grausam die Jesusfigur in ihren Handlungen und Wunderwirkungen oft letztlich auftritt: Jesus ist an menschlichen Schicksalen und deren Verbesserung interessiert, er ist Humanist in einem einerseits karitativen, andererseits den Rest der Schöpfung dem Humanum unterordnenden Sinn. Viele der Grausamkeiten, die Russell aufführt, wenden sich gegen Tiere, die in der Tat im Neuen Testament nur als Nutztiere von Belang sind und schon einmal dafür herhalten müssen, dass die Teufel in sie fahren und sie elendiglich umkommen. Dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sei, ist zwar eine alttestamentarische Formel, ihr Gehalt wird im Neuen Testament jedoch erst greifbar in seinen inhaltlichen Konsequenzen, auch und gerade in der Christusfigur. Anselm Feuerbach zog daraus die radikale Konsequenz und erklärt in "Grundsätze der Philosophie der Zukunft", §1: "Die Aufgabe der neueren Zeit war die Verwirklichung und Vermenschlichung Gottes – die Verwandlung und Auflösung der Theologie in die Anthropologie."
Die christliche Welt ist keineswegs, wie gerne in aktuellen Diskursen behauptet wird, eine der Achtsamkeit auch gegenüber den nicht-menschlichen Mitgeschöpfen. Das war bei Jesus nicht so und nicht in den ersten urchristlichen Gemeinden. Und das war auch nicht bei Franz von Assisi so, der heute von manchen als "Gottes grüner Krieger" (Franz Alt) gefeiert wird. Das soziale Engagement ist christliches Erbgut, nicht das ökologische. "Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan" (Matthäus 25,40) - so lautet eine der zentralen christlichen Botschaften. Und sie meint nicht "Bruder Sonne" und "Schwester Mond" (gemäß dem Geschlecht im Italienischen), von denen Franz von Assisi in seinem Sonnengesang spricht. Simone Weil würde dem allerdings energisch widersprechen: "Christus hat das Vegetative erlöst, nicht das Soziale. Er hat nicht für die Welt gebetet." (Simone Weil, Schwerkraft und Gnade, München 1952, S. 216)
Zur "Leiblichkeit" der christlichen Religion genügt schon der Verweis auf Lukas 22:19: "Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis." Damit knüpft das Christentum an die Tradition kultischer Menschenopfer an, die bereits im Mithras-Kult zeitgenössisch in die Überlagerung von Stieropfer und Mithrasopfer sublimiert war. Auch können wir hinweisen auf die "Auferstehung des Fleisches" als Glaubensinhalt des Christentums. Eine der eigenartigsten Lehren des Christentums, die noch im 19. Jahrhundert zu aufgeregten Debatten darüber führte, ob Christen sich nach dem Tode verbrennen lassen dürften. In der Organspende-Debatte wird bisweilen auch heute noch von manchen Sekten mit dieser Lehre argumentiert.
Eine leibliche Unsterblichkeit kennen wir aus Altägypten mit der Einbalsamierung der Pharaonen, die bereits im Neuen Reich ab 1.550 v. Chr. gleichsam demokratisiert war (nach ersten Tendenzen dazu schon zum Ende des Alten Reiches) zu einer Möglichkeit für jeden Ägypter. Diese "Demokratisierung" wird im Christentum institutionalisiert mit der Lehre von der Auferstehung des Leibes. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus hierzu: "Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein geistiger Leib" (1 Kor 15,44). Im Zweiten Vatikanischen Konzil wird dieser "Auferstehungsleib" 1965 in der Konstitution "Lumen gentium" allerdings entindividualisiert zum Leib der Einheit in und mit Christus, mit dem biblischen Verweis auf die Wiederkunft Christi, "der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird zur Gleichgestalt mit dem Leibe seiner Herrlichkeit" (Phil 3,21). Letztlich spricht sich das 2. Vatikanum damit gegen den individuellen Auferstehungsleib aus. Es stellt sich die Frage, was da noch vom Auferstehungsleib bleibe. Paulus hat ihm schon die Leiblichkeit abgesprochen, das 2. Vatikanum nun auch die Personalität.
Dahinter verbirgt sich eine der Paradoxien des Christentums, einerseits den modernen Individualismus ideologisch mit zu begründen in der Unmittelbarkeit des Einzelnen zu Gott, andererseits wird ein starkes Kollektiv gebildet in der Nachfolge Christi mit der Aufforderung, alte Bindungen - die ja auch individuell geschichtlich gewordene Identität bedeuten - aufzugeben. Nietzsche warf dem von Paulus begründeten Christentum vor, eine Lehre der "Herden-Bildung" geworden zu sein, gegen die ursprüngliche Lehre Christi, die eine individuelle diesseitige Erfüllung propagiert habe ("Der Antichrist", 42 und passim).
Was dem Christentum oft als "Leibfeindlichkeit" angelastet wurde, geht teilweise auf Paulus zurück, darüber hinaus auf die manichäischen Einflüsse in der Lehre des Augustinus und schließlich auf Züge des Protestantismus. Über der Kritik hieran sollte nicht übersehen werden, welchen außerordentlichen Schritt die damit verbundene Auffassung von der Gottesebenbildlichkeit des Christus darin tat, dass dieser "Sohn Gottes" anders als alle seine Vorgänger daraus keinen politischen Herrschaftsanspruch ableitete. "Mein Reich ist nicht von dieser Welt" mag eskapistisch anmuten. Und es hat den christlichen Kirchen nicht erspart, immer wieder für politische Zwecke eingesetzt zu werden oder sich selbst machtpolitisch aufzustellen. Es blieb jedoch dem Islam vorbehalten, Religion wieder substantiell als Instrument weltlicher Herrschaft zu begründen.
Sören Kierkegaard (1813-1855) fordert in der "Einübung im Christentum" eine Wiederentdeckung der ursprünglichen christlichen Lehre, die für jeden individuellen Einzelnen einen Einweihungspfad anbiete, der mehr fordere als die von Nietzsche und cum grano salis auch Kierkegaard selbst kritisierte "Herden-Bildung". Der prägende Autor des Christentums als Religion der Individualität war jedoch Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Am 14.12.1803 schreibt er an Karl Gustav Brinckmann, den Freund gemeinsamer Studienzeiten bei den Herrnhutern: "Das Ausgehen von der Individualität bleibt aber gewiß der höchste Standpunkt, da er zugleich den der Allgemeinheit und der Identität in sich schließt."
Der Gott der Lichtwerdung
Eine der über Jahrhunderte erfolgreichsten Religionen der
Welt, mit einer Ausdehnung von Westeuropa bis China, vom 3.
nachchristlichen Jahrhundert bis ins 16. Jahrhundert, war
der Manichäismus. In der Forschungsliteratur wird der
Manichäismus bisweilen auch als ernsthafte Konkurrenz des
Christentums in Spätantike und frühem Mittelalter angesehen.
Ihr bekanntester Anhänger war der spätere "Kirchenvater"
Augustinus in seinen Jugendjahren. Seine Neuformulierung des
Christentums ist vielfältig durch den Manichäismus geprägt,
in Abgrenzung wie in Übernahmen.Der Begründer Mani wurde um das Jahr 216 in Mardinu bei Seleukeia-Ktesiphon am Tigris (beim heutigen Bagdad) geboren, und wuchs ab seinem vierten Lebensjahr mit seinem Vater in einer rein männlichen Gemeinde der jüdisch-christlichen Täufersekte der Elchasaiten/Elkesaiten auf. Mit zwölf (nach anderen Quellen elf) Jahren erlebte er, so die Überlieferung, seine erste Erleuchtung in der Begegnung mit seinem "kosmischen Zwilling" - nach einem Konzept der frühen indoeuropäischen Religiosität. Mit 24 erfuhr er sich als "kosmischer Zwilling" von Jesus und begann seine eigene Missionstätigkeit. Dem Vorbild des Apostels Thomas (dessen Name "Zwilling" bedeutet) folgend, dem er sich besonders verbunden fühlte, brach er im Jahr 240 zu einer Missionsreise nach Indien auf. Nach einigen Wundertaten, Heilungen und Exorzismen wurde er dort als Reinkarnation Buddhas angesehen. Dann missionierte er im Iran, wo er Mitglieder des Sassaniden-Hofes für seine Religion gewinnen konnte. Am Hof schrieb er später seine Lehre nieder, die er nun als die eigentliche authentische Lehre Zoroasters bezeichnete, im "Šābūragān" für König Šābuhr (Regentenzeit 240-270). Nach Jahren der Verfolgung durch den zoroastrischen Klerus, insbesondere den Reformer Kartir Hangirpe, starb er während einer Haft am Hof des sassanidischen Königs Bahram I. in Gundishapur an Folterfolgen oder nach anderen Quellen durch Hinrichtung 276/77. Seine Anhänger sprachen von "Kreuzigung", um auch darin an Jesus anzuknüpfen.
Mani berief sich auf Zoroaster, Buddha und Jesus. Er hielt deren Lehren für unvollständig, zu sehr am Individuum orientiert. Sein Anliegen war die Schaffung einer
 Universalreligion,
welche die nach seinem Urteil besten Elemente der drei
Religionen verbinden sollte. Vom frühen Christentum nahm er
die Verinnerlichung der Lichtverehrung, vom Buddhismus die
Erlösung der Erwählten durch Aufgehen in einem Umfassenden
und vom Zoroastrismus die Unbedingtheit der Moral.
Unübersehbar ist dabei und daneben vor allem der Einfluss
der Gnosis. Seinen theologisch ausgearbeiteten Entwurf
nannte er "Religion des Lichtes". Damit ist - wie schon im
frühen Christentum und vor allem der Gnosis - anderes
gemeint als die alte Sonnenverehrung. Licht ist, neben der
Dunkelheit, bei ihm eine der Ursubstanzen des Seienden,
beide sind ineins materiell und geistig-seelisch. Aufgabe
religiösen Lebens ist im Manichäismus, das Licht wieder zu
befreien aus dem Gefängnis in der dunklen Materie, zu der
auch der menschliche Körper, genauer: das an diesem
"Grobstoffliche", gehört. Diese Befreiung bedeutete bei Mani
nicht individuelle Auferstehung, sondern Aufgehen in Gott
als Licht. Die überlieferten Schöpfungsgeschichten wurden
bei Mani radikal umgedeutet als vorübergehende Störung einer
feinstofflichen Existenzform, die durch religiöse Praxis
rückgängig gemacht werden könne - die wiederum erst durch
Schöpfung möglich wurde. Die Auflösung dieses
Zirkelschlusses gelingt Mani nur über komplexe kosmogonische
Konstruktionen, die äußerliche Parallelen in den aktuellsten
Theoriebildungen zum Zusammenspiel von Supernovae, Schwarzen
Löchern und Urknall haben. Astronomisch-kosmologische
Aussagen der Manichäer wurden allerdings schon von
Augustinus als sachlich unrichtig kritisiert
(Drecoll/Kudella 2011, S. 81ff).
Universalreligion,
welche die nach seinem Urteil besten Elemente der drei
Religionen verbinden sollte. Vom frühen Christentum nahm er
die Verinnerlichung der Lichtverehrung, vom Buddhismus die
Erlösung der Erwählten durch Aufgehen in einem Umfassenden
und vom Zoroastrismus die Unbedingtheit der Moral.
Unübersehbar ist dabei und daneben vor allem der Einfluss
der Gnosis. Seinen theologisch ausgearbeiteten Entwurf
nannte er "Religion des Lichtes". Damit ist - wie schon im
frühen Christentum und vor allem der Gnosis - anderes
gemeint als die alte Sonnenverehrung. Licht ist, neben der
Dunkelheit, bei ihm eine der Ursubstanzen des Seienden,
beide sind ineins materiell und geistig-seelisch. Aufgabe
religiösen Lebens ist im Manichäismus, das Licht wieder zu
befreien aus dem Gefängnis in der dunklen Materie, zu der
auch der menschliche Körper, genauer: das an diesem
"Grobstoffliche", gehört. Diese Befreiung bedeutete bei Mani
nicht individuelle Auferstehung, sondern Aufgehen in Gott
als Licht. Die überlieferten Schöpfungsgeschichten wurden
bei Mani radikal umgedeutet als vorübergehende Störung einer
feinstofflichen Existenzform, die durch religiöse Praxis
rückgängig gemacht werden könne - die wiederum erst durch
Schöpfung möglich wurde. Die Auflösung dieses
Zirkelschlusses gelingt Mani nur über komplexe kosmogonische
Konstruktionen, die äußerliche Parallelen in den aktuellsten
Theoriebildungen zum Zusammenspiel von Supernovae, Schwarzen
Löchern und Urknall haben. Astronomisch-kosmologische
Aussagen der Manichäer wurden allerdings schon von
Augustinus als sachlich unrichtig kritisiert
(Drecoll/Kudella 2011, S. 81ff).Im Manichäismus wird das im Christentum schon früh gepflegte Konzept der weltlichen Existenz als Jammertal ins Extrem getrieben und eine Erlösungsperspektive einzig durch eigenes Verhalten propagiert. Vieles von dem, was dem Christentum des Kirchenvaters Augustinus nachgesagt wird, Leibfeindlichkeit im Besonderen, gilt in strukturell auszeichnender Weise für den Manichäismus. Aus heutiger Sicht äußerst befremdend ist, was Mani in einem seiner Grundlagentexte, dem Šābuhragān, über das Aufwachsen des Kindes schreibt: "And when (the human child) is born, it nourishes the body and soul from these very miscarriages of the devs and from the mixture of the gods, and (by this means) it lives and reaches maturity. And it becomes a garment for Az and a vessel for desire." (Handschrift M 7983, Zeilen 1204ff, zitiert nach Merecki/Beduhn 2001, S. 6). Abgeleitet daraus wird ein Fortpflanzungsverbot für die Electi und ein Fortpflanzungsverzicht für die Auditores. Der Mensch ist bei Mani - und zwar schon vor dem Sündenfall - eine Bedrohung der restlichen Schöpfung: "Aber weder Wasser noch Feuer noch Bäume noch Geschöpfe werden durch ihn froh." (ebd. Zeilen 1221-1224, zitiert nach Hutter 1992, S. 107).
Das dritte nachchristliche Jahrhundert brachte den Zerfall des römischen Reiches und des Partherreiches sowie klimatische Krisen, die Region befand sich in Aufruhr, was extreme religiöse Strömungen begünstigte. Ob die pessimistischen Grundzüge des Manichäismus bezüglich des Menschen über Augustinus in das Christentum kamen oder ob die Lehre des Augustinus eine innere Entwicklung des Christentums spiegelt, bleibt dahingestellt. Erinnert sei daran, dass Mani in einer rein männlichen, jüdisch-christlichen Täufergemeinschaft aufgewachsen war, die vieles von dem bereits praktizierte, was er mit neuer Begründung forderte, etwa Fleischverzicht und sexuelle Enthaltsamkeit. Von dieser Sekte distanzierte er sich allerdings mit 24 Jahren entschieden.
In Manis im philosophischen Sinne materialistischer Lehre war das Licht feinstofflicher Träger aller geistig-spirituellen Phänomene, aber diese weitgehend abhängig auch von den grobstofflichen Prozessen. Mit der grobmateriellen Schöpfung wurde das Licht gleichsam gefangen gesetzt, was unter anderem zur Folge hat, dass die falsche Ernährung (etwa mit Fleisch) das Lichthafte im Menschen blockiert, gar zerstört. Doch nicht nur die Nahrungsaufnahme, auch die Gestirne und die Sinneswahrnehmungen nehmen Einfluß auf die Seele und ihren Befreiungsweg - oder eben dessen Scheitern. Damit entwickelt Mani eine weitgehend stringende Erklärung des Leib-Seele-Problems, wie wir sie ähnlich aus der Stoa und später von Spinoza kennen. Und er bietet innerhalb seiner Kosmogonie auch eine übergreifende Begründung für den Verzicht auf Sexualität und Fortpflanzung als Fortsetzungen der Licht-Gefangenschaft. Besonders bemerkenswert ist seine Lehre durch eine Unterscheidung in Gut und Böse, die quer läuft zur Unterscheidung Körper-Seele, auch wenn dies nicht immer durchgehalten wird. Sein Dualismus mit einer klaren Substantialisierung des Bösen, die schon von Augustinus kritisch gesehen wurde, war offen für die vor allem von den Katharern später streng ausgeführte Unterscheidung in bösen dunklen Körper und gute (Licht-)Seele, aber auch offen für die christliche Vorstellung von der Auferstehung des Fleisches.
Der Manichäismus radikalisierte die in allen anderen großen Religionen vorhandene Verheißung einer Erlösung aus den Willfährnissen der körperlichen Welt, als da sind Unfall, Unglück, Leid, Schmerz, Krankheit, Böswilligkeit, Krieg und Tod, in einer stringenten Erzählung von der Gefangenschaft des Lichtes in dunkler Materie und seiner Erlösung durch das Werk der Religion. Die Gläubigen zerfielen für Mani, wie in der Gnosis, in zwei Klassen, Erwählte/Electi und Hörer/Auditores, die Laien ("Hörer" ist ein Begriff aus dem frühen Buddhismus für die ersten Anhänger des Buddha). Laien haben die Chance, durch Erwählte mit erlöst zu werden oder mit Anleitung durch die Erwählten günstige Voraussetzungen für eine Wiedergeburt als Erwählte zu erlangen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Mani von seiner Indien-Mission die Wiedergeburts-Lehre mitbrachte.
Was sich im Zoroastrismus schon andeutet (in den Gathas vor allem in Y. 31,20), wird im Manichäismus drastisch ausgestaltet: Die Gegenwelt der Hölle als Strafe für die Verfallenheit an die grobmaterielle Welt. Mani scheint sich dabei am Buddhismus orientiert zu haben. Für den Zoroasthrismus seiner Zeit war Manis Lehre eine Provokation in vielen Hinsichten. Es begann damit, dass er seine Lehre als die eigentlich authentische Form des Zoroastrismus bezeichnete. Das dem Zoroasthrismus heilige Feuer sah er als affiziert durch Dunkelheit an und der Reinigung bedürftig. Familie und Gesellschaft waren grundsätzlich verdächtig, im Dienst der bösen Kräfte zu stehen. Als Religion zur Mobilisierung gegen politische Gegner taugte der Manichäismus wenig, da seine bösen Mächte in allen von uns wirksam sind. Und wenn er in den Kephalaia häufig unterscheidet in die Anhänger seiner Lehre und neidische Gegner geschieht dies vor allem zur Warnung vor Verfolgung, nicht als Aufforderung zur Abgrenzung. Der Manichäismus folgte bei seiner Ausbreitung nach Ost und West Handelswegen, nicht militärischen Operationen.
Ein klares Gottesbild ist im Manichäismus schwer zu erkennen. Der Eklektizismus seiner Lehre bedingte die Zusammenführung unterschiedlicher Götter und Gottesvorstellungen in einen religiösen Kosmos, der zugleich Astronomie-Astrologie und Elementelehre integrierte. In ihrer Grundstruktur ist seine Lehre dualistisch, mit zwei uranfänglichen Prinzipien, Licht mit der Konkretisierung Ohrmizd als Urmensch und Finsternis mit der Konkretisierung Ahrmen, deren Kampf die Leidensgeschichte der stofflichen Welt einleitet und deren unheilvolle Verbindung die für die Menschheit relevante Welt erschafft (s. Handschrift M 7980, Zeile 533, Hutter 1995, S. 58). Es ist Aufgabe der Menschheit, diese Verbindung aufzulösen zugunsten des Lichtes - durch Enthaltsamkeit und Achtsamkeit.
Ein wesentlicher Kritikpunkt der frühen - christlichen - Gegner des Manichäismus war der Vorwurf, die Schöpfung werde über den Schöpfer gestellt. Als Götzendienst wurde die Auffassung kritisiert, die "Himmelslichter" Sonne und Mond (bei Franz von Assisi tausend Jahre nach Mani als "Bruder" und "Schwester" angesprochen) seien ein Bindeglied für den Aufstieg befreiter Lichtteile von der weltlichen Schöpfung ins Lichtreich.So etwa bei einem alexandrinischen Bischof, vermutlich Theonas (282-300), der in einem Gemeindebrief Dtn. 17,2ff zitiert: "Wenn bei dir in einer deiner Städte, die dir der HERR, dein Gott, geben wird, jemand gefunden wird, Mann oder Frau, der da tut, was dem HERRN, deinem Gott, missfällt, dass er seinen Bund übertritt und hingeht und dient andern Göttern und betet sie an, es sei Sonne oder Mond oder das ganze Heer des Himmels, was ich nicht geboten habe, und es wird dir angezeigt und du hörst es, so sollst du gründlich danach forschen. Und wenn du findest, dass es gewiss wahr ist, dass solch ein Gräuel in Israel geschehen ist, so sollst du den Mann oder die Frau, die eine solche Übeltat begangen haben, hinausführen zu deinem Tor und sollst sie zu Tode steinigen."
Quelle: Manfred Hutter, Manis kosmogonische Šābuhragān-Texte, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992. Iain Gardner, The Kephalaia of the Teacher, Leiden u.a.: Brill, 1995
Lektüreempfehlungen:
Paul Merecki/Jason Beduhn (Hrsg.), The Light and the Darkness. Studies in Manichaeism and its World, Leiden u.a.: Brill, 2001
Volker Henning Drecoll/Mirjam Kudella, Augustin und der Manichäismus, Tübingen: Siebeck, 2011
Richard Foltz, Religions of Iran. From Prehistory to the Present, London: Oneworld Publications, 2013
Abbildung: Seite aus einer manichäischen Handschrift des 8./9. Jahrhunderts
Gott als Kampfgefährte
Muhammad ibn Abd Allah wurde in Mekka 570 geboren, sein
Vater starb kurz vor der Geburt, seine Mutter als er sechs
Jahre alt war. Er lebte gleich nach der Geburt bei seiner
Amme, später bei seinem Großvater. Der Großvater bezog seine
Einnahmen teilweise aus dem Pilgerwesen. Später wurde
Mohammed von einem Onkel mit auf Handelsreisen genommen, auf
denen er das Christentum vertieft kennenlernte. Mit 40
Jahren begründete er den Islam, 622 übersiedelt der
Religionsgründer auf Druck seiner Gegner von Mekka nach
Yathrib/Medina, 630 eroberte er mit seinen Anhängern Mekka,
632 starb er dort.Sein Erweckungserlebnis hatte Mohammed nach seinem eigenen Bericht im Jahr 610, während des Ramadan, des "heißen Monats" im arabischen Kalender. Ein knappes Bekenntnis dieses Erlebnisses ist in der Sure 96:1-5 zu finden. Diese - wie auch andere Suren im Umkreis des Erweckungserlebnisses - zeigt das Vorbild der Psalmen. Mohammeds Auftreten orientierte sich in der Folge an den Figuren von Mose und Jesus, die im Koran beständig präsent sind, auch namentlich. Aufgewachsen im multireligiösen Pilgerort Mekka, dessen Kaaba von Abraham erbaut worden sei, bei einem mit dem Pilgerwesen beruflich befassten Großvater, war Mohammed mit der jüdischen und mit der christlichen Überlieferung bestens vertraut. Von ihnen übernahm er den radikalen Monotheismus, den er verband mit einer Neubelebung des Tieropfers und mit vormonotheistischen Göttlichkeitsvorstellungen, die das Numinose als fortdauernd in der Schöpfung tätig wirksam ansahen. Er verstand seine Lehre - ähnlich wie Mani - als Weiterentwicklung und Vollendung der vorgefundenen Religonen. Seine Lehre und seine Anhängerschaft wurden in Mekka sowohl von jüdischer wie christlicher Seite, als auch von Anhängern polytheistischer Religionen angegriffen.
In aktuellen Debatten wird vor dem Hintergrund islamistisch-fundamentalistischer Gewalttaten und Machtergreifungen in verschiedenen Staaten die grundsätzliche Friedensfähigkeit des Islam thematisiert. Kritisch schreibt dazu Tilman Nagel in "Islam oder Islamismus? Probleme einer Grenzziehung" schon 2005: "Islam und Islamismus sind so lange nicht voneinander zu trennen, wie Koran und Sunna als absolut und für alle Zeiten wahr ausgegeben werden." Obgleich seine Position unter gewandelten Diskursbedingungen zwischenzeitlich als islamophob verdächtigt wurde, wird Nagel noch zustimmend zitiert von Hamed Abdel-Samad 2023 in "Islam. Eine kritische Geschichte" (Abdel-Samad 2023, S. 238f). Abdel-Samad wendet sich entschieden dagegen, aus dem Koran eine Friedensbotschaft herauslesen zu wollen. "Wer bestimmte Passagen aus dem Koran als Legitimation für den Frieden heranzieht, spielt letztlich das Spiel der Fundamentalisten, die andere Passagen als Rechtfertigung für Gewalt zitieren." (Abdel-Samad 2023, S. 282) Abdel-Samad legt vielmehr dar, wie der Islam mit dem einer Vertreibung nahekommenden Umzug (der "Hidschra") der Gemeinde Mohammeds nach Medina zu einer Religion der gewaltsamen Auseinandersetzung mit den Gegner wurde, was 630 schließlich zur Eroberung Mekkas durch die Anhänger Mohammeds führte (Abdel-Samad 2023, S. 77-88 = Kapitel 2: "Von Mekka nach Medina: Die Geburt der Scharia aus dem Geist des Krieges"). Der Islamwissenschaftler Heinz Halm weist allerdings drauf hin, dass die Idee der Verbindung von Staat und Religion nach der Auflösung des Osmanischen Reiches aufgegeben wurde (s. Halm 2018, S. 59f).
Sowenig das Christentum sich mit Ableitungen aus der Bibel zur Öko-Religon erklären lässt, so wenig kann überzeugend der Islam mit Ableitungen aus dem Koran zur Friedensreligion erklärt werden. Klar ist allerdings zu erkennen, dass mit den "Ungläubigen" im Koran Polytheisten gemeint sind, nur ihnen gelten explitzite Kampfansagen. Anhänger monotheistischer Religionen mit einem Orientierung gebenden "Buch" als göttlicher Offenbarung werden geachtet und konnten im Einflußgebiet des Islam in der Regel ihren Kultus geschützt ausüben (vgl. Halm 2018, S. 27ff).
Im Islam ist allerdings strukturell weit eher als im Christentum ein achtsamer Umgang mit der Natur angelegt, insbesondere durch die Überzeugung von der fortdauernden Präsenz Gottes in seiner Schöpfung. Die herausragende Bedeutung der knappen Ressource Wasser und die immerwährende Bedrohung der Oasen im Entstehungsbereich des Islam durch Wüste schlagen sich in Passagen des Koran nieder, die durchaus ein im heutigen Sinne "ökologisches" Naturverhältnis propagieren. Besonders prägnant ist die Sure 4:119, wo ausführt wird, wie der Satan Ungläubige dazu verführt, die Schöpfung zu verunstalten. In der Sure 55:11-14 wird deutlich gemacht, dass die Schöpfung nicht für den Menschen alleine, sondern für alle Geschöpfe gemacht sei. Das Bild des Gartens steht repräsentativ für die Naturauffassung des Islam. Im Koran finden sich 150 Stellen zu Garten ("dschanna"), davon 59 Stellen zum Paradiesgarten - der nach islamischer Vorstellung in Mekka lag, im Bereich der Kaaba. In der Sura al-Baqara erscheint der Garten als Erfüllungsort für die Gläubigen, die wohltätig sind einzig um Allah zufrieden zu stellen und für das eigene Seelenheil, nicht vordergründiger Anerkennung wegen. Dem Garten gegenübergestellt ist der Stein, der von einer Schicht Muttererde überzogen ist, die bei Regen abgespült wird (2:265) - während der Garten bei Regen reiche Früchte trägt (2:266).
Im regnerischen Frühjahr 2023 war ich eine Woche im Schwarzwald unterwegs. Beim Warten auf einen Bus holte ich mir einen Döner beim Imbiss an der Haltestelle und setzte mich nach draußen. Als es gerade wieder einmal zu nieseln begann, kam der Wirt, um die Markise weiter auszufahren. Er stelle sich neben mich und meinte: "Ich bin Moslem. Für uns ist der Regen sehr wichtig!" Was mich etwas irritierte, denn Regen ist doch unanbhängig von der Religion für alle Landwirte und Gärtner, letztlich für uns alle von Bedeutung. Doch im Schwarzwald muss man sich selten vor Dürren fürchten. Seine Äußerung macht aufmerksam auf zweierlei, das nicht nur für den Islam gilt: Religionen machen abhängig von ihren Entstehungsumständen besonders sensibel für bestimmte Weltphänomene. Und ihre Mitglieder neigen dazu, diese Sensibilität als Bestimmungsmerkmal zu verstehen. Damit sei nicht der klischeehaften Auffassung das Wort geredet, der Islam sei eine Religion der Wüste. Heinz Halm hat klar herausgestellt, dass er eine Religion der Städte, der Handelszentren war (s. Halm 2018, S. 22).
Im Sufismus, einer mystischen Strömung des Islam, sind nicht vorrangig Ungläubige, sei es als politisch-religiöse Gegner, sei es als Bedroher der Schöpfung, Agenten der Gottferne, sondern der Dogmatismus der eigenen Religion. Rābi'a al-'Adawiyya, dem Sufismus zugeordnete islamische Mystikerin des 8. Jahrhunderts, ging einer Legende zufolge durch die Straßen ihrer Stadt Basra mit einem Eimer Wasser in einer Hand und einer Fackel in der anderen: "Ich will Wasser in die Hölle gießen und Feuer ans Paradies legen, damit diese beiden Schleier verschwinden und niemand mehr Gott aus Furcht vor der Hölle oder in Hoffnung auf das Paradies anbete, sondern nur noch um Seiner ewigen Schönheit willen." (zit. n. Schimmel 1982, S. 21)
Lektüreempfehlungen:
Annemarie Schimmel (Hrsg.): Gärten der Erkenntnis. Das Buch der vierzig Sufi-Meister, München: Dieterichs, 1982
Heinz Halm: Der Islam. Geschichte und Gegenwart, München: Beck, 2018 (11., aktualisierte, Auflage)
Hamed Abdel-Samad, Islam. Eine kritische Geschichte, München: dtv, 2023
Joachim von Fiore. Das Dritte Reich des Geistes
Joachim von Fiore (~1130/35-1202) war Sohn eines Notars in Diensten des normannischen Hofes, geboren in Celico/Kalabrien, an den Hängen des Sila-Gebirges bei Cosenza. Nach einer standesgemäßen Ausbildung arbeitete er einige Jahre als Notar in Cosenza und dann in der Kanzlei am Hof von Wilhelm I. in Palermo. Ab etwa 1160 widmete er sich verstärkt religiösen Themen, pilgerte 1166/67 nach Jerusalem, zog als Prediger durch die Lande und trat schließlich in das Zisterzienserkloster Corazzo ein, wo er als Abt wirkte. Bemühungen, sein Kloster einem anderen zu affilieren, scheiterten zweimal mit der Begründung, seine Mönche seien zu arm. 1188 wurde Corazzo an Fossanova (Latium) affiliert. Joachim verließ dann sein Kloster und zog sich zurück, sammelte in seiner Einsiedelei jedoch eine Gruppe von Anhängern um sich, mit denen er ein Johannes-Kloster im Sila-Gebirge gründete, das die Regel des Heiligen Benedikt erneuern sollte. 1191 wurde sein Orden der Florenser anerkannt, als strengere Abspaltung von den Zisterziensern, die ihrerseites erst 1098 als Orden einer strengeren Observanz des Benediktinertums bestätigt waren. Joachim lebte und wirkte im zeitlichen und konzeptionellen Umfeld einer außergewöhnlichen Belebung des Mönchtums und der Blüte zahlreicher religiöser Bewegungen, etwa des Katharertums, er war älterer Zeitgenosse des Franz von Assisi und des Dominikus von Caleruega.Er begann seine religiöse Wirksamkeit als apokalyptischer Wanderprediger, der das unmittelbar bevorstehende Erscheinen des Antichristen und den Anbruch des Tausendjährigen Reiches verkündete. Wie auch die anderen Apokalyptiker seiner Zeit bezog er sich dabei auf das Johannesevangelium. 1185 hatte er nach eigenem späteren Bekenntnis bei der Lektüre des Johannesevangelium (Joh. 14,16ff) zu Ostern seine Vision vom Dritten Reich des Geistes, das angebrochen sei, nach dem Reich des Vaters und dem Reich des Sohnes. Seine um das Jahr 1200 ausgearbeitete Konzeption vom Dritten Reich ist widersprüchlich und bricht implizite mit den vertrauten messianischen Konzeptionen, die er selbst zunächst vermutlich vertreten hatte, in zweifacher Weise. Zum einen folgen seine drei Reiche nicht abrupt aufeinander, sie überschneiden sich vielmehr. Zum zweiten verdankt sich die Verwirklichung des Dritten Reiches nicht einer singulären Erlöserfigur, Protagonisten sind vielmehr im Grundsatz alle Menschen, vorrangig gelehrte Mönche, aber auch Laien, Männer wie Frauen, ausgezeichnet durch eine besondere Gottesnähe ohne Unterwerfung oder Gefolgschaft. "Es ist nicht nur der Kreuzestod Christi, der von den Sünden befreit, die Erlösung ex toto bringt erst die endzeitliche Ausgießung des Heiligen Geistes." (Riedl 2004, S. 268).
Das Reich des Vaters (mit dem Gott Abrahams) ist nach einer berühmten späten Bildtafel des Joachim zunächst bestimmt durch das Alte Testament, dann auch durch das
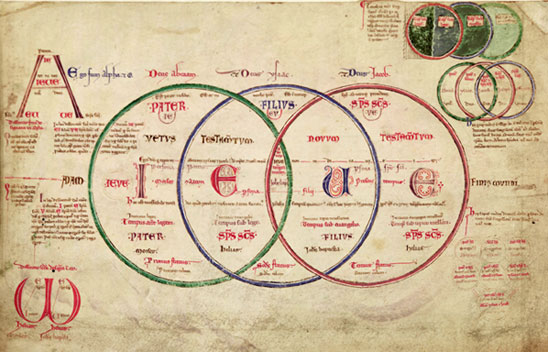 Neue.
Das Reich des Sohnes (mit dem Gott Isaaks) ist bestimmt
durch das Alte und das Neue Testament gleichermaßen. Und das
Reich des Geistes (mit dem Gott Jakobs) wird greifbar
zunächst im Alten Testament, dann ausschließlich im Neuen,
mit Christus als Verkünder des Geistes der Wahrheit. Die
Auflösung der Trinität in drei historisch aufeinander
folgende Stufen ist eine der originellsten Leistungen
Joachims, auch wenn sie auf der christlichen Auslegung des
Alten Testamentes als Vordeutung Christi und anderen
heilsgeschichtlichen Lehren seiner Zeit aufbaute.
Bemerkenswert ist auch seine vollkommen diesseitige
Auffassung des heilsgeschichtlichen Abschlusses in einem
"Dritten Reich", gegen die Jenseitsorientierung bei Paulus
und Augustinus. Der Teufel und die Hölle haben keinen
substantiellen Platz in seiner Lehre, die trotz ihrer
starken Formalisierungen Religion prozessual versteht. "Der
Geist ist es, der die verdorbene Natur des Menschen heilt
und ihn damit der göttlichen Sohnschaft würdig macht."
(Riedl 2004, S. 269) Heilsgeschichte wird bei Joachim zur
Fortschrittsgeschichte und zur Realisierung einer sozialen
Utopie. Der fleischliche Leib wird bereits vor der
Auferstehung der Toden in einen geistigen verwandelt - und
nicht zugunsten des geistigen abgetötet. "Im Unterschied zu
Paulus aber glaubt Joachim, daß sich der Wesenswandel vom
animalischen zum geistlichen Menschen geschichtlich
vollzieht" (Riedl 2004, S. 266). Dazu finden wir allerdings
schon bei Augustinus Ansätze, etwa wenn er von den
Nachkommen Kains sagt, sie seien zwar "zunächst böse und
fleischlich", dann aber werden sie "durch Wiedergeburt und
Wachstum in Christus" später "gut und geistlich" (De
civitate dei, XV,1).
Neue.
Das Reich des Sohnes (mit dem Gott Isaaks) ist bestimmt
durch das Alte und das Neue Testament gleichermaßen. Und das
Reich des Geistes (mit dem Gott Jakobs) wird greifbar
zunächst im Alten Testament, dann ausschließlich im Neuen,
mit Christus als Verkünder des Geistes der Wahrheit. Die
Auflösung der Trinität in drei historisch aufeinander
folgende Stufen ist eine der originellsten Leistungen
Joachims, auch wenn sie auf der christlichen Auslegung des
Alten Testamentes als Vordeutung Christi und anderen
heilsgeschichtlichen Lehren seiner Zeit aufbaute.
Bemerkenswert ist auch seine vollkommen diesseitige
Auffassung des heilsgeschichtlichen Abschlusses in einem
"Dritten Reich", gegen die Jenseitsorientierung bei Paulus
und Augustinus. Der Teufel und die Hölle haben keinen
substantiellen Platz in seiner Lehre, die trotz ihrer
starken Formalisierungen Religion prozessual versteht. "Der
Geist ist es, der die verdorbene Natur des Menschen heilt
und ihn damit der göttlichen Sohnschaft würdig macht."
(Riedl 2004, S. 269) Heilsgeschichte wird bei Joachim zur
Fortschrittsgeschichte und zur Realisierung einer sozialen
Utopie. Der fleischliche Leib wird bereits vor der
Auferstehung der Toden in einen geistigen verwandelt - und
nicht zugunsten des geistigen abgetötet. "Im Unterschied zu
Paulus aber glaubt Joachim, daß sich der Wesenswandel vom
animalischen zum geistlichen Menschen geschichtlich
vollzieht" (Riedl 2004, S. 266). Dazu finden wir allerdings
schon bei Augustinus Ansätze, etwa wenn er von den
Nachkommen Kains sagt, sie seien zwar "zunächst böse und
fleischlich", dann aber werden sie "durch Wiedergeburt und
Wachstum in Christus" später "gut und geistlich" (De
civitate dei, XV,1).Joachims Geist-Gott greift wieder den Ansatz zur gesellschaftlichen Organisation auf, der den alttestamentarischen Gott auszeichnet, legt nun aber die Entwicklung von Regelwerken in die Hände der Menschen, die Mitglied der Kirche sind, ob Mann oder Frau, als Aushandlung und Einsicht, nicht als rigide Gesetzesbefolgung. Fiores kategoriale Bestimmungen für diese Phase der Menschheitsentwicklung lauten: "noch reichere Gnade", "Vollkommenheit der Erkenntnis", "Freiheit", "Liebe" und "Freundschaft". Der Beginn habe bei Benedikt von Nursia gelegen, im Überschneidungsbereich aller drei "Reiche". Nach diesem tausendjährigen Friedensreich (das nach dem Joachimschen Schema genau besehen zur Lebenszeit Joachims bereits 500 Jahre währte) folgt allerdings auch bei Joachim das "Finis mundi" mit dem etablierten Programm, Auferstehung der Toten, Jüngstes Gericht.
Joachims Einfluss auf Lessings Aufklärung und die Geistphilosophie Hegels ist bekannt, auch wenn dieser Einfluss inhaltlich bei beiden kaum explizit wird. Auguste Comte reihte den Ordensgründer ein in die Ahnenreihe des Positivismus. Friedrich Engels bezieht sich in seinem Buch über den Bauernkrieg auf Joachim von Fiore, später Ernst Bloch in "Das Prinzip Hoffnung". Für den Soziologen Eugen Rosenstock-Huessy war die russische Revolution ideologisch durch Joachim von Fiore inspiriert. Die immer wieder behaupteten Bezüge des Nationalsozialismus zu Fiores Konzeption vom "Dritten Reich des Geistes" - angeblich vermittelt durch Arthur Moeller van den Brucks Buch "Das Dritte Reich" von 1923 - lassen sich nicht belegen. Moeller erwähnt Joachim von Fiore nicht, bezieht sich allerdings gelegentlich auf Hegel. Im übrigen hat der Nationalsozialismus sich entschieden von Moellers Konzeption einer konservativen Revolution distanziert (vgl. André Schlüter 2010). Und die Prophezeiung eines Tausendjährigen Reiches stammt aus der Johannes-Offenbarung, 20. Kapitel. Gelegentlich wird zur näheren Bestimmung auch auf Joh. 18,36 und andere Bibelstellen verwiesen, die allerdings keine Zeitdauer nennen.
Matthias Riedl kommt in seiner materialreichen politologischen Dissertation allerdings zum Schluß, dass Joachim "weder ein Revolutionär noch ein Utopist, sondern ein Reformer" gewesen sei, ein Reformer der bestehenden "römisch-katholischen Papstkirche" (Riedl 2004, S. 204). Joachims Vision war, so Riedl, die "vollendete Kirche" mit dem Ende jeder weltlichen Herrschaft im Diesseits (Riedl 2004, S. 278). Vergleiche mit dem Philosophenstaat Platons drängen sich auf, aber auch der Begriff "Gottesstaat", ohne das dualistische Komplement einer Civitas terrena wie bei Augustinus.
Quelle: Marjorie Reeves/Beatrice Hirsch-Reich, The Figurae of Joachim of Fiore, Oxford: Oxford University Press, 1972
Lektüreempfehlung: Matthias Riedl, Joachim von Fiore. Denker der vollendeten Menschheit, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004
Abbildung: Trinitätskreise aus dem Liber Figurarum des Joachim von Fiore
Zimzum - Gott und der leere Raum
Die jüdische Kabbala erlebte im 16. Jahrhundert eine Zeit intensiver Erneuerung in der Stadt Safed, auf 840 Metern Höhe in den Bergen Galiläas gelegen. Sie gehörte damals zum Osmanischen Reich, das Religionsfreiheit gewährte und zuließ, dass Safed, eine der vier heiligen Städte des Judentums, sich zum Zentrum jüdisch-kabbalistischer Gelehrsamkeit entwickelte. Dies unter anderem durch den Zustrom spanischer Juden, die nach dem Religionsdekret von 1492 ihre Heimat verlassen hatten.In dieser Stadt, die zugleich als Handelsmetropole und für die Textilherstellung wichtig war, lebte ab 1569 der Kabbalist Isaak Luria, geboren 1534 in Jerusalem, gestorben 1572 in Safed. Als junger Familienvater hatte er in Kairo gearbeitet, im Umfeld eines wohlhabenden Onkels, als Händler für Pfeffer, Wein, Weizen, Leder und Seide. Zugleich war er Schüler der Oberrabbiner von Ägypten. Häufig zog sich Luria unter der Woche zur religiösen Versenkung auf eine Nilinsel zurück, die dem Onkel gehörte. In Safed wurde er dann Schüler des damals maßgeblichen Kabbalisten Cordovero. Nach dessen Tod stieg er 1570 umgehend zu einem der führenden Kabbalisten Safeds auf und sammelte rasch eine in verschiedene Chavurot (Gemeinschaften) gegliederte Schülerschaft um sich.
Seine Lehre trug er nur mündlich vor, seine Schüler wurden von ihm dazu verpflichtet, keine Inhalte des Unterrichts weiterzugeben. Im Zentrum des für die Nachwelt besonders bedeutsamen Teils seiner Lehre steht das Zimzum, der Rückzug Gottes. In der rabbinischen Tradition wurde der Begriff der Selbstkonzentration ("azamzem") Gottes verwendet für Gottes Einzug in die Bundeslade des Volkes Israel zur Bestätigung des Mosaischen Bundes. Im Sohar finden wir bereits einen Rückzug, der den Lurias vordeutet, als "zurückgezogenes Licht" im Abschnitt "Das Licht des Urquells" (Der Sohar, Diederichs Verlag 1982, S. 50) - das allerdings ein Geschaffenes ist. Bei Luria gibt es deutliche Ansätze, dieses Urlicht mit Gott zu identifizieren. Und bei ihm erscheint nun nach den Darstellungen seiner Schüler eine allererste Zusammenziehung, Selbstbeschränkung Gottes VOR dem Beginn der Schöpfung. Diese bedeutet nicht die Konzentration an einem Ort, sondern das Freimachen eines Ortes in Gottes Mitte. Gott als Ejn Sof, als Unendliches, als allumfassendes Licht, zieht sich von diesem Ort zurück und hinterlässt einen lichtlosen, gott-losen Raum. In diesem Raum vollzieht sich dann, einer schlauchförmigen Ausstülpung des das Nichts umgebenden Ejn Sof (das Unendliche Licht, eine Charakterisierung Gottes) folgend, die Emanation der 10 Sefirot und die Entstehung der 4 Welten, von denen die letzte, die unterste, unsere menschliche Welt, die dinghaft-materielle Welt ist, Assija.
Zweiter Zentralbegriff mit neuer Deutung wurde in Lurias Lehre der "Tikkun". In der jüdischen Tradition bedeutet dieser Begriff "Reparatur, Heilung" im Sinne sozialer Fürsorge und Gerechtigkeit. Die Kabbala, insbesondere in der Fassung Lurias und seiner Schüler, wendet den Begriff vom menschlich-moralischen Bereich in die kosmologische Ordnung und bezeichnet damit den Heilsweg der Menschheit zur Überwindung des Bösen in der Schöpfung. Mit seinem Begriff des Tikkun verbindet Luria den Bereich des zurückgezogenen Gottes mit der materiellen Schöpfung, denn das religiös verpflichtete gute Handeln der Menschen (was bei Luria vor allem Askese, Gebet, religiöse Praktiken meint) löst die in der Schöpfung gefangenen Lichtteile und vereint sie wieder mit dem Ejn Sof. Parallelen zur Lehre des Manichäismus sind unübersehbar - es bleibt nur offen, wie diese Parallelen zu erklären sind, durch zufällige Strukturanalogien oder gemeinsame Quellen (etwa gnostische, die dem Rabbinertum als Häresien galten), durch einen Einfluss des Manichäismus auf Luria oder durch manichäisch beeinflusste Deutungen der Lehre Lurias in der Rezeptionsgeschichte.
Und was ist das, was "repariert" werden soll durch den Tikkun? Der dritte Zentralbegriff der lurianischen Kosmologie, neben Zimzum und Emanation (die sehr schwankend bestimmt wird), ist der "Bruch der Gefäße" (shvirat ha-kelim). Mit ihm kommt das Übel in die Welt, mit ihm werden Lichtteile der Emanation gefangen und zur Befreiung im Tikkun bereit gemacht. Dabei bleibt die Lehre Lurias allerdings zwiespältig. Sie vermag die gnostische Doppelheit von Gott und Demiurg nicht befriedigend aufzulösen und hat kein schlüssiges Modell der Emanation. Ihre Konzeption des Zimzum als Schaffung eines leeren Raumes in der Mitte Gottes bleibt jedoch als substantieller Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Verbindung von Gottesidee und Kosmologie bestehen.
Es waren die Schüler Lurias, die nach seinem frühen Tod die Lehre bekannt machten und verbreiteten, allen voran Chajim Vital und Joseph ibn Tabul, die der gleichen Chavura angehört hatten und offenkundig in einem Konkurrenzverhältnis zueinander standen (s. Schulte 2014, S. 48 und S. 80). Vital vor allem hat die Lehre Lurias systematisiert und in zahlreichen Schriften festgehalten, wieweit es dabei auch zu Abweichungen oder Ergänzungen kam, kann nur spekuliert werden. Allerdings gibt es zur kosmologisch-theologischen Darstellung des Zimzum und der nachfolgenden Schöpfung bei Vital weitgehende Übereinstimmung mit dem von Ibn Tabul überlieferten Text Drusch Chefzi Ba, der allerdings erst postum von seinen Schülern verbreitet wurde.
Die komplexe Überlieferungslage macht es schwierig, klar festzulegen, was die Zimzum-Lehre bei Luria selbst ausmacht. Der Philosoph und Judaist Christoph Schulte betont in seinem Werk "Zimzum. Gott und Weltursprung", welches die Rezeption der Denkfigur des Zimzum bis in die Gegenwart verfolgt, die Differenz zwischen Gott und der Schöpfung, die Leere des von Gott bei seinem Rückzug zurückgelassenen Raumes. Der Judaist Gerold Necker vertritt dagegen in seiner Publikation "Einführung in die lurianische Kabbala" im Anschluss an Gershom Scholem die Auffassung, dass Luria in seinen späteren Vorträgen "die unüberwindliche Trennung zwischen Gott und seiner Schöpfung durchlässiger gemacht" habe (Necker 2008, S. 83).
Die Lehre Lurias kann als Versuch gelesen werden, die Theodizee-Frage ohne Rekurs auf eine Schuld-Sühne-Konstellation zu beantworten. Gershom Scholem sah darin, zumindest im Konjunktiv, eine Reaktion auf die Vertreibung der jüdischen Glaubensgemeinschaften aus Portugal und Spanien (die auch Lurias Familie betraf). Gott selbst sei demnach "ins Exil" gegangen im Zimzum. Festzuhalten bleibt, dass die Darstellungen der lurianischen Lehre sehr heterogen sind, das geht hin bis zu konträren Deutungen. Für die einen ist das lurianische Zimzum die entschiedenste Abkehr von der "creatio ex nihilo"-Idee, für die anderen eine eigenständige Variante dieser. Für die einen steht es für die Abwesenheit Gottes von dieser Welt, für die anderen leistet sie eine besonders differenzierte Deutung der Präsenz Gottes in seiner Schöpfung. Zu beiden Deutungskonflikten empfiehlt sich die Lektüre von Necker 2008, S. 80-130, "Gott in der Schöpfung", im Kern die Seiten 84 bis 87. Ich persönlich sehe in der Denkfigur des Zimzum als Rückzug Gottes von sich selbst in sich selbst den Schlüssel zu einem ersten Verständnis Gottes als unvollkommen, fehlbar, vorläufig. Eine Aufforderung auch, das "Wo Es war, soll Ich werden" Freuds neu zu bedenken für die Ich-süchtige Gegenwart in seiner Umkehr, "Wo Ich war, soll Es werden" - keineswegs aber als reaktionärer Salto zurück.
Der Orientalist Erich Bischoff setzt in seinem 1917 in stark überarbeiteter und erweiterter zweiter Auflage erschienenen Werk "Die Kabbalah. Einführung in die jüdische Mystik und Geheimwissenschaft" den Zimzum auch in Beziehung zum Begriff "Pyknosis" ("Verdichtung") der ionischen Naturphilosophie (Bischoff 1917, S. 99). Allerdings steht dieser in einem obligaten Wechselverhältnis zum Begriff der "Manosis" ("Verdünnung") und soll die Entstehung der Welt aus Urstoffen erklären. Für das Zimzum erfüllt der Begriff der "Emanation" in einem hoch problematischen Sinne die Funktion des Gegenbegriffs. Problematisch, da mit der Emanation ja das Numinose doch wieder in die Schöpfung gerät, der es nach Lurias Vorstellung ja gerade einen Eigenraum gelassen hatte.

Um den Stellenwert der Zimzum-Denkfigur bei Luria angemessen einschätzen zu können, ist es sicherlich sinnvoll, auch die Elemente praktisch-magischer Kabbala im Wirken Lurias zur Kenntnis zu nehmen. Erich Bischoff zitiert Chajim Vital, der von Luria berichtet habe, "daß er vermöge seiner kabbalistischen Kenntnisse auch die Sprache der Bäume, Pflanzen, Mineralien, Flammen usw., die Sprache der Engel und den Gesang der Vögel, sowie die Bedeutung des Vogelflugs verstanden (...) habe, (...). Auch habe er die Seelen Lebender und Toter gesehen und mit ihnen geredet und von ihnen himmlische Geheimnisse erfahren." (Bischoff 1917, S. 120f) Bei Necker findet sich diesen Bericht desgleichen (Necker 2008, S. 39), ferner detaillierte Ausführungen zur Seelenwanderungslehre bei Luria und zu Besessenheitsheilungen in seinem Umkreis (Necker 2008, S. 145-152).
In jüngerer Zeit wird die Denkfigur des Zimzum vor allem in einer anthropologisch adaptierten Variante bedeutsam, als Modell für eine Tugend des Rückzugs, der Zurückhaltung, des Zurücknehmens eigener Herrschaftsansprüche, wie Christoph Schulte herausarbeitete. "Viele, insbesondere die künstlerischen, Aneignungen des Zimzum im 20. Jahrhundert sind gekennzeichnet durch eine Tendenz, den Zimzum von der göttlichen in eine menschliche Sphäre zu übertragen, von Mystik und Theologie in die Anthropologie." (Schulte 2014, S. 447). Ein Ansatz, der sich ja schon in der jüdischen Rezeption, prägnant vor allem bei Abraham Herrera ("Puerta del Cielo" , Anfang 17. Jahrhundert) findet.
Gewiss muss man dazu nicht unbedingt auf die Denkfigur des Zimzum zurückgreifen, die streng gedacht dazu ohnedies nicht taugt, da Gott bei Luria sich keineswegs aus der Schöpfung zurückzieht, sondern gerade durch seine Kontraktion den Raum schafft, in welchem er dann emanierend die Schöpfung initiiert. Einer Schöpfung, die in der Darstellung Gerold Neckers schon im Ejn Sof angelegt gewesen sei (s. Necker 2008, S. 80ff). Und im Übrigen könnte eine derartige "Imitatio Dei" im Kontext innerweltlichen Gewinns (mehr Kreativität, besseres Management etwa - vgl. Schulz 2014, S. 447f) auch den Verdacht der Hybris wecken. Eine bescheidenere Referenz für die Tugend der Selbstrücknahme findet sich etwa bei Ursula Kroeber Le Guin, in ihrem Essay "A Non-Euclidean View of California as a Cold Place to Be" von 1982/83. Sie zitiert dort gleich zu Beginn eine Redensart der nordamerikanischen Cree, "Usà puyew usu wapiw", die übersetzt bedeutet "He goes backward, looks foreward". Was sie dazu ausführt, ist die Aufforderung zu einer innerweltlichen Achtsamkeit gegenüber Mitmenschen und Naturzusammenhang.
Der wohl bekannteste Künstler, der sich auf die Vorstellung des Zimzum beruft, ist Anselm Kiefer mit seinem 1990 geschaffenen Werk ZimZum und einigen weiteren Werken, die einen kabbalistischen Bezug haben. Sein Kollege Barnett Newman konzipierte 1969 zwei betretbare Stahlskulpturen mit dem Titel "Zim Zum". Eine davon, die monumentale Nummer II, wurde erst 1985 realisiert und steht in Düsseldorf, im Park der Kunstsammlung NRW.
Die Attraktivität des Konzeptes ist weiterhin ungebrochen, wobei der inhaltliche Bezug oft diffus bleibt. 2020 kündigten die religiösen Vereinigungen Gebetshaus Augsburg, Shine (Campus für Christus), Holy Spirit Night, ICF (International Christian Followship) und CVJM das "ZimZum Festival" für Jugendliche an, im Zeichen "charismatischer Erneuerung", zunächst für 2021, dann verschoben auf 2022 und schließlich auf 2025, wo es dann Anfang Januar in Augsburg stattfand.
Im Kontext aktueller kosmologischer Erkenntnisse könnte die Zimzum-Idee als heuristisches Werkzeug beigezogen werden, thematisiert sie doch in ausgezeichneter Weise die Frage, was vor der Schöpfung "unserer" Welt denn gewesen sei. Mit dem Big Bang, wie das von zahlreichen Stars des Film- und Musikbetriebs sehr geschätzte kalifornische Kabbalah Centre in Publikationen nahelegt, hat das Zimzum Lurias allerdings nichts zu schaffen. Setzt dieses doch weit vor der Welt des Assija an, der die Urknall-Konzeption inhaltlich zugehört.
Lektüreempfehlungen:
Erich Bischoff, Die Kabbalah. Einführung in die jüdische Mystik und Geheimwissenschaft, Leipzig: Grieben, 1917 (2., erheblich erweiterte Auflage, zuerst 1903)
Gerold Necker, Einführung in die lurianische Kabbala, Ffm/Leipzig: Verlag der Weltreligionen, 2008
Christoph Schulte, Zimzum. Gott und Weltursprung, Tübingen: Mohr Siebeck, 2014
Abbildung: Anselm Kiefer, Zimzum, 1990
Deus Sive Natura - Baruch Spinoza
 Der Beitrag Spinozas (1632-1677)
zur Gottesauffassung wird im Allgemeinen mit der Formel
"deus sive natura" benannt, verstanden als "Gott=Natur".
Spinoza lieferte damit zum einen die
philosophisch-theologische Begründung für einen
respektvollen Umgang mit der gegebenen Welt als
Vergegenwärtigung Gottes, zum anderen provozierte er damit
die jüdische ebenso wie die christliche Orthodoxie, indem er
die Sonderstellung des Menschen Gott gegenüber ihres
theologischen Fundamentes beraubte und damit auch die
Messias-Figuration in Frage stellte.
Der Beitrag Spinozas (1632-1677)
zur Gottesauffassung wird im Allgemeinen mit der Formel
"deus sive natura" benannt, verstanden als "Gott=Natur".
Spinoza lieferte damit zum einen die
philosophisch-theologische Begründung für einen
respektvollen Umgang mit der gegebenen Welt als
Vergegenwärtigung Gottes, zum anderen provozierte er damit
die jüdische ebenso wie die christliche Orthodoxie, indem er
die Sonderstellung des Menschen Gott gegenüber ihres
theologischen Fundamentes beraubte und damit auch die
Messias-Figuration in Frage stellte.Dass bei Spinoza in der Tat eine Gleichsetzung von Gott und Natur gemeint ist, zeigt die häufig zitierte Passage in seiner posthum erschienenen "Ethik", mit den Verbformen im Singular: "Ratio igitur, seu causa, cur Deus, seu Natura agit, & cur existit, una, eademque est." (Ethik, Teil IV, Vorwort, Reclam-Ausgabe 1977, S. 438 - "Also ist der Grund oder die Ursache, warum Gott, d.h. die Natur, handelt und warum er existiert, ein und dieselbe."). Die damit formulierte pantheistisch-naturalistische Position bedeutet allerdings noch keine klare Absage an eine besondere Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Der Mensch könnte ja in Analogie zur Schöpfungskraft der Natur/Gottes tätig werden. Immerhin erwartet Spinoza vom Menschen, dass er die Einheit seines Geistes mit der Natur begreife ("Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes" - Einleitung, Absatz 13) - und damit zum Glück gelange. Der Ausgangspunkt der Philosophie Spinozas war eine durchaus der Buddhas vergleichbare Bemühung um eine Auffassung von Gott und der Welt, die unabhängig von zufälligen Lebensumständen und Stimmungen Glück sichere.
Spinoza unterscheidet an der Natur - und damit an Gott - im Anschluss an die scholastische Tradition im ersten Teil der "Ethica" die "natura naturans" von der "natura naturata". Die auf Aristoteles zurückgehende Unterscheidung finden wir in den Aristoteles-Übersetzungen und Kommentaren von Averroës und Michael Scottus im 12. Jahrhundert. Die "natura naturans" wurde in der Scholastik verstanden als Schöpfergott und scharf getrennt von der "natura naturata", der Schöpfung mit den Geschöpfen. Spinoza hebt diese Unterscheidung nun auf, beide zusammen machen bei ihm Gott/die Natur aus. Damit schafft er ein System, innerhalb dessen alles Seiende Gott ist und damit vollkommen. Realität und Vollkommenheit sind für Spinoza ein und das selbe, "per realitatem, & perfectionem idem intelligo" (Ethica Pars II, Definitiones VI). Alle menschlichen Fähigkeiten sind nichts weiter als Teil der "natura naturata", explizit gilt dies auch für den "intellectum" (Ethica Pars I, Propositio XXXI). Und diese gewordene Natur ist "in Gott" - wie er unter anderem ausführt in seiner "Kurzen Abhandlung", Erster Teil, Zweites Kapitel. Der Theologe Klaus Müller vertritt - unter anderem in "Streit um Gott" 2006 - die Auffassung, Spinoza habe wesentlich dazu beigetragen, die "All-Einheitsintuition" in das Christentum zu integrieren (Müller 2006, S. 15, 89ff und passim).
Spinoza schneidet radikal alle Versuche ab, ein Gottesbild zu formulieren, das religiöse Dogmatik, Kultus und Sakramente begründet. Sein Gott, seine Natur ist wesentlich durch zwei Attribute, und nur durch diese, nämlich Denken und Ausdehnung gekennzeichnet. Da ist kein Platz für Gebote oder Strafen, aber auch nicht für Gnadenakte. Bis hin zur Aussage, "Daher kann man nicht sagen, Gott liebe die Menschen" - "Kurze Abhandlung", Zweiter Teil, Vierundzwanzigstes Kapitel, Abschnitt 2. Dies hat ihm immer wieder den Vorwurf des Atheismus eingebracht. Doch Gott wird von ihm bezeugt als Ziel der "amor Dei", die den Menschen auszeichne. Dargestellt wird diese Liebe in der "Kurzen Abhandlung", Zweiter Teil, Zweiundzwanzigstes Kapitel, als eine Liebe aus umfassender Erkenntnis in das Wesen Gottes, der uns und die Welt begründet und ausmacht. Für Ernst Bloch manifestiert sich darin ein Umschlag in Mystik bei Spinoza. Nimmt man Theismus als Lehre von der Existenz eines persönlichen Gottes, gilt der Vorwurf des Atheismus Bloch zufolge gleichwohl bezogen auf das System Spinozas.
Ein gängiges positives Urteil zu Spinoza besagt, dass er ein Beweis dafür sei, dass ein Mensch auch ohne Glaube an Gott ein zutiefst ethisches Leben führen könne. Doch Spinoza war gläubig, er glaubte an einen Sinnzusammenhang von allem, von Allem im umfassendsten Sinne verstanden, garantiert durch die erkennbare Einheit von Gott und Natur. Seine Ethik entspricht ganz und gar seinem Gottesbild, es gibt in dieser Ethik keine Gebote und Verbote, keine Strafen und keine Belohnungen. Spinoza benötigt keine Teufel und Dämonen, "um die Ursachen von Haß, Neid, Zorn und dergleichen Leidenschaften zu finden, weil wir diese Ursachen ohne derartige Fiktionen genugsam gefunden haben" (Spinoza 1991, S. 115).
Die Ursachen dieser Leidenschaften sind für Spinoza falsche Meinungen, Irrtümer, verfehlte Lernprozesse. Spinoza hat mit Scharfsinn bereits moderne psychologische, psychosoziale und psychophysiologische Konzepte wie soziales Lernen, Modelllernen, Kondiditionierung, Traumatisierung oder Belohnungssystem (innerpsychisch wohlgemerkt, nicht als Lohn durch Gott) vorgedacht zur Begründung und Therapie schädlicher "Leidenschaften". Im Kapitel "Von der wahren Freiheit" in der "Kurzen Abhandlung" erklärt Spinoza, dass wir Leidenschaften nicht "bezwingen" können, sondern nur aufheben in der Freiheit unserer Gotteserkenntnis. Konkret hat er dies ausgeführt in einem vorangegangenen Kapitel, "Von unsrer Glückseligkeit". Dort fordert er explizite eine Versöhnung mit unserer Körperlichkeit, denn "die Ursache der Liebe, des Hasses und der Trauer (dürfen) nicht im Körper gesucht werden". Vielmehr müsse "die Seele" aufgeklärt werden, um schädliche Leidenschaften zu überwinden. Allerdings erklärt er an anderer Stelle auch,"daß man sich um diesen Körper nicht kümmern solle" (Spinoza 1991, S. 103). Einen Lobpreis der Leiblichkeit dürfen wir also bei Spinoza nicht erwarten.
Gut und schlecht sind für Spinoza nur "Modi des Denkens". Sobald wir dies aufgeklärt haben, ist der Weg frei, die als "schlecht" eingeschätzten Verhaltensweisen auf ihre Begründung hin zu befragen und durch Aufklärung und korrigierende Intervention ein für das eigene Glück und das gesellschaftliche Ganze (zu diesem siehe Ethika Zweiter Teil, Lehrsatz 49, Anmerkung Ende) adäquateres Verhalten zu motivieren. Gott hat als moralische Instanz hier keinen Platz mehr, das macht Spinoza in seiner Ethik ganz deutlich, wo er im Anhang zum Ersten Teil, "De DEO", die Vorstellung von hilfreichen und strafenden, zweckhaft handelnden Göttern als Aberglaube darstellt, der auf Unwissenheit basiere. Wissen aber ist das, was er "Ordine Geometrico" vermitteln möchte.
Lektüreempfehlungen:
Baruch de Spinoza, Kurze Abhandlung von Gott, dem Menschen und dessen Glück. Auf Grundlage der Übersetzung von Carl Gebhardt neu herausgegeben von Wolfgang Bartuschat, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1991 (= Sämtliche Werke Bd. 1)
Baruch de Spinoza, Briefwechsel, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2017 (= Sämtliche Werke Bd. 6)
Heinrich Scholz (Hrsg,), Die Hauptschriften zum Pantheismusstreit zwischen Jacobi und Mendelssohn, Berlin: Reuther & Reichard, 1916
Arno Münster (Hrsg.), Ernst Bloch und Spinoza. Erläuterungen zu den Leipziger Vorlesungen, Mössingen-Talheim: Talheimer Verlag, 2021
Abbildung: Franz Wulfhagen, Portrait Spinozas, 1664
Friedrich Wilhelm Joseph Schellings Konzept von einem werdenden Gott
Im Blick auf heute noch wirkmächtige Gottesvorstellungen ist die Rezeption der lurianischen Kabbala im Deutschen Idealismus von Bedeutung. Isaak Luria 1534-1572 entwickelte eine spezifische Vorstellung des kabbalistischen "Zimzum", wonach Gott durch seinen Rückzug, seine Kontraktion oder Konzentration, einen Raum für die Schöpfung freigab (s.o. im Essay "Zimzum - Gott und der leere Raum"). Bei Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854) kulminiert die philosophisch-theologische Rezeption der Denkfigur des "Zimzum" von christlicher Seite in der auch aus anderen Quellen gespeisten Konzeption eines "werdenden" Gottes.
Mit dem Universalgelehrten Christian Knorr von Rosenroth hatte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die christliche Beschäftigung mit der Denkfigur des Zimzum begonnen. Und dies mit Ausblendung des metaphorischen Verständnisses, wie es in der jüdischen Rezeption bestimmend geworden war. Knorr übersetzte ein kabbalistisches Grundwerk von Abraham Herrera, "Puerta del Cielo", aus dessen hebräischer Übersetzung durch Isaac Aboab de Fonseca ins Lateinische, wobei er Abschnitte zu Herreras metaphorischer Auffassung des Zimzum wegfallen ließ (s. Schulte 2014, S. 138ff). Er veröffentlichte seine Übersetzung zusammen mit anderen Texten der Kabbala, darunter der "Sohar", unter dem Titel "Kabbala Denudata" - mit dem im Titel und im Titelkupfer explizit gemachten Programm eines exoterischen Kabbala-Verständnisses, das bereits unverkennbar Züge der späteren Aufklärungsphilosophie zeigt.
Der württembergische Pietist Friedrich Christoph Oetinger und der Spinozismus-Kritiker Friedrich Heinrich Jacobi setzten sich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven mit Knorrs Publikation und der Idee des Zimzum auseinander. Oetinger besaß auch die Lehrsammlung "Sefer Etz Chaim" des Luria-Schülers Chaajim Vital sowie als seine wichtigste Quelle zur Kabbala das Werk "Sefer Mishnat Hasidim" von Raphael Immanuel ben Abraham Ḥai Ricchi. Er übersetzte Zimzum als "Zusammenziehung Gottes". Jacobi verwendete den Begriff "Contraktion". Ausführlich dargestellt ist dies bei Schulte 2014, S. 188ff und S. 289ff. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling arbeitete sich an beiden Autoren ab in seinem Bemühen, den Begriff "Gott" nach der Kritik der Aufklärung neu zu denken. Für seine Wendung von der Identitätsphilosophie zu einer Philosophie des lebendigen Gottes in der Schrift "Philosophie und Religion" von 1804 bot die Denkfigur des Zimzum, wie er sie wohl vor allem von Oetinger her kannte, einen entscheidenden Schlüssel. Seine Schrift beginnt im ersten Kapitel, "Idee des Absoluten", mit dem bemerkenswerten Satz: "Ganz gemäß der Absicht, außer der Philosophie einen leeren Raum zu erhalten, welchen die Seele durch Glauben und Andacht ausfüllen könnte, wäre es, über dem Absoluten und Ewigen noch Gott, als die unendlichmal höhere Potenz von jenem zu setzen." HKA I.14, S. 282. Hier figuriert Gott selbst als "leerer Raum", ein Bezug zur lurianischen Kabbala drängt sich auf. Im Hintergrund steht allerdings Schellings Zurückweisung der transzendentalphilosophischen Ausgrenzung Gottes aus dem Themenbereich der Philosophie. Was nach Schelling nicht zulässig sei, da es kein Absolutes über dem Absoluten gebe.
Die "Kontraktion Gottes" erscheint bei Schelling erstmals 1810 in den (nach Schellings Tod 1854 veröffentlichten) "Stuttgarter Privatvorlesungen". Dort zitiert Schelling aus dem Goetheschen Gedicht "Natur und Kunst", das schon den anthropologisch-psychologischen Ansatz der Zimzum-Rezeption im 20. Jahrhundert vorwegzunehmen scheint, "Wer Großes will, muß sich zusammenraffen,/ in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister." (HKA II.8, S. 86). Und dies gilt bei Schelling im Privatissimum auch für Gott: "Inzwischen ist der Anfang der Schöpfung allerdings eine Herablassung Gottes; er läßt sich eigentlich herab ins Reale, contrahiert sich ganz in dieses." HKA II.8, S. 88. Zwei Seiten davor hatte er schon, im direkten Anschluss an das Goethe-Zitat, präzisiert: "Contraction aber ist der Anfang aller Realität." - HKA II.8, S. 86. In der 3. Allgemeinen Anmerkung zur ersten Vorlesung führt Schelling aus, was er letztlich von Oetinger gelernt hat: "Durch die Selbsteinschränkung Gottes wird nur ein Anfang der Zeit, aber nicht ein Anfang in der Zeit gesetzt. Gott selbst ist darum nicht in die Zeit gesetzt." - HKA II.8, S. 88f. Schon diese Passagen machen deutlich, dass Schellings Zusammenziehung (Kontraktion, Selbsteinschränkung) strukturell wenig zu tun hat mit dem, was Luria mit dem Zimzum benannte, funktional aber durchaus, als Schöpfungsursprung. Das bleibt auch so mit seinen Ausführungen zur Kontraktion Gottes in den "Weltalter"-Entwürfen aus dem Nachlass. Dort finden wir unter anderem Schellings Konzeption der Einheit von Kontraktion und Expansion. Diese könnte auch auf Schellings Giordano Bruno-Studien zurückgehen, wie Wilhelm Schmidt-Biggemann vermutet (Schellingiana 13.1, S. 46 - dort in einer Fußnote festgehalten in Abgrenzung zu Habermas, dessen Auffassung einer Luria-Rezeption bei Schelling Christoph Schulte aufgreift). So schreibt Schelling in den Weltalter-Fragmenten (Nachlasskonvolut 80) über den "bewußten Gott" von der beständigen "Contraction u. Expansion, Einathmen und Ausatmen" (Schellingiana 13.1, S. 132). Gegen eine besondere Verbindung Schellings mit Lurias Konzeption des Zimzum spricht auch der Passus vor dem Goethe-Zitat, wo, wenngleich ohne expliziten Bezug auf Gott, Selbstbeschränkung bedeutet "sich einzuschließen in Einen Punkt, aber diesen auch festhalten mit allen Kräften, nicht ablassen, bis er zu einer Welt expandiert ist" (HKA II.8, S. 86). Die Kontraktion Gottes bedeutet bei Schelling gerade nicht Platz lassen für Anderes, sondern Konzentration für die Schaffung von Eigenem.
Wohlgemerkt hat Schelling den Begriff der Kontraktion im Blick auf Gottes Wirken in keiner zu Lebzeiten veröffentlichten Schrift verwendet. Sein von Spinoza inspiriertes Programm eines "werdenden" Gottes kann sich jedoch durchaus verbunden sehen mit Lurias Idee eines "sich selbst" für die Schöpfung beschränkenden Gottes. Und Schelling liefert eine Begründung dafür, warum Gott sich für die Schöpfung beschränkt: Um zu sich selbst zu kommen. In der Georgii-Nachschrift zur Stuttgarter Privatvorlesung von 1810 lesen wir zum "Leben" Gottes: "sein Wesen geht nur dadurch in Existenz über, daß er sich contrahirt" (HKA II.8, S. 87). Seine "Herablassung" dient nicht lediglich der Schöpfung per se, sondern auch Gott selbst. Schelling verweist in seiner 1809 veröffentlichten Freiheitsschrift auch ausdrücklich auf die lange Geschichte der Vorstellung eines werdenden Gottes, wobei er, recht großzügig, Leidensfähigkeit und Prozesshaftigkeit der Existenz Gottes in eins setzt: "Ohne den Begriff eines menschlich leidenden Gottes, der allen Mysterien und geistigen Religionen der Vorzeit gemein ist, bleibt die ganze Geschichte unbegreiflich; auch die Schrift (gemeint ist die "Heilige Schrift", die Bibel - H. Sch.) unterscheidet Perioden der Offenbarung und setzt als eine ferne Zukunft die Zeit, da Gott Alles in Allem, d.h. wo er ganz verwirklicht seyn wird." (HKA I.17, S. 168) Hier formuliert er die Grundidee seines "Weltalter"-Projektes, in welchem er letztlich eine Geschichte Gottes schreiben möchte.
Abschließend kurz ein Hinweis auf die prägenden Ereignisse im Umkreis von Schellings Ausformulierung seiner Konzeption vom "werdenden Gott". Im Jahr 1800 gerät Schelling in eine existentielle Krise nach dem Tod der fünfzehnjährigen Tochter Caroline Schlegels aus erster Ehe, Auguste Böhmer. Schelling stand Auguste sehr nahe und griff offenkundig auch in den Krankheitsverlauf ein, als das Mädchen sich in Bad Bocklet mit Ruhr infiziert hatte. Vom Umfeld wurde ihm eine Mitschuld am Tod gegeben, da er der Kranken Opium verabreicht habe. Auf Veranlassung Carolines bemühte sich Goethe damals darum, Schelling zu stabilisieren. 1809 starb die inzwischen mit Schelling verheiratete Caroline gleichfalls an der Ruhr. Danach widmete sich Schelling bis zu seinem Tod über vier Jahrzehnte dem "Weltalter"-Projekt, das unvollendet blieb und von ihm auch nicht in Teilen zur Veröffentlichung freigegeben wurde. Im Juni 1812 heiratete er die Tochter einer Freundin Carolines, Pauline Gotter, mit der er sechs Kinder hatte. Ein Ruf zurück an die Akademie von Jena, wo er bereits 1798 bis 1801 gelehrt hatte, wurde ihm 1816 verweigert nach Intervention durch Jenenser Theologen, die eine ablehnende Stellungnahme Goethes bewirkten, der in einem Brief an den Geheimrat Christian Gottlob von Voigt vom 27. Februar 1816 resümiert, dass es ihm "komisch vorkommt, wenn wir zur dritten Säkularfeier unseres protestantisch wahrhaft großen Gewinnes das alte überwundene Zeug nun wieder unter einer erneuten mystisch-pantheistischen, abstrus-philosophischen, obgleich im stillen keineswegs zu verachtenden Form wieder eingeführt sehen sollten".
Der diskrete Hinweis auf die "im stillen keineswegs zu verachtende Form" macht deutlich, dass Goethe vor allem einen öffentlichen Skandal fürchtete, inhaltlich Schelling aber durchaus nahe stand, zumal dem Schelling der Anti-Jacobi-Schrift von 1812, "Denkmal von den göttlichen Dingen ...". Goethe fürchtete unter anderem Anstoß am Konzept des Werdenden Gottes. Das aus heutiger Sicht wirklich neue und theologisch brisante an Schellings Gottesbegriff ist allerdings das für Schelling bestimmende Moment, welches den werdenden Gott erst begründet: Freiheit. Schellings Gott ist kein Gott der Gnade oder der Liebe. Er ist ein Gott der Freiheit!
Lektüreempfehlungen:
Christoph Schulte, Zimzum. Gott und Weltursprung, Tübingen: Mohr Siebeck, 2014
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Philosophie und Religion (1804), in: Historisch-kritische Ausgabe, Reihe I, Bd. 14, Stuttgart-Bad Cannstatt 2021
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809), in: Historisch-kritische Ausgabe, Reihe I, Bd. 17, Stuttgart-Bad Cannstatt 2018
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Stuttgarter Privatvorlesungen (1810), in: Historisch-kritische Ausgabe, Reihe II, Nachlass 8, Stuttgart-Bad Cannstatt 2017
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Weltalter-Fragmente, 2 Bände, Stuttgart-Bad Cannstatt 2002 (= Schellingiana 13.1 und 13.2)
Friedrich Nietzsche: Gott ist tot!
Es ist ein Weinen in der Welt,
als ob der liebe Gott gestorben wär,
und der bleierne Schatten, der niederfällt,
lastet grabesschwer.
Else Lasker-Schüler, "Weltende", 1903
Historisch am ältesten ist die Auffassung vom konkreten Tod eines konkret gedachten Gottes. Sie begegnet in der Kulturgeschichte nach Philipp David in drei heuristisch idealisierten, miteinander verschränkten Varianten: Als Tod und Wiederauferstehung eines dem Jahreskreislauf verbundenen Gottes; als Tod eines jüngeren (männlichen) Gottes, der von einer älteren (weiblichen) Gottheit betrauert wird - etwa in der Paarung Inanna/Ischtar und Dumuzi/Tammuz (s. David 2023, S. 150); als Tod eines partikularen Gottes, der das Leben anderer Götter oder eines anderen Gottes ermöglicht.
Nachfolgend geht es um die historisch jüngste Auffassung vom Ende des Glaubens an einen Gott. Bei Nietzsche finden wir die Überzeugung vom "Tod Gottes" als Zeitdiagnose, "daß der Glaube an den christlichen Gott unglaubwürdig geworden ist". So nüchtern expliziert er im "Fünften Buch" von "Die Fröhliche Wissenschaft", was hinter seinem meist mit Verweis auf den "tollen Menschen" zitierten Diktum vom Tod Gottes steht. An anderer Stelle finden wir bei ihm die Feststellungen "tot sind alle Götter" und "alle Götter sind Dichter-Gleichnis, Dichter-Erschleichnis" (Kapitel "Von den Dichtern" in "Also sprach Zarathustra").
Lange vor Nietzsche war es ein Grundanliegen der Aufklärung, den Glauben an einen kirchlich vertretenen Gott zu ersetzen durch den Glauben an die Vernunft. Eine Schlüsselfigur im deutschsprachigen Raum ist Gotthold Ephraim Lessing, der Aufsehen machte durch die von Friedrich Heinrich Jacobi weitergetragene (nach mancher Auffassung: gefäschte) Äußerung von 1780 "Die orthodoxen Begriffe von der Gottheit sind nicht mehr für mich; ich kann sie nicht genießen. Ἓν καὶ Πᾶν! Ich weiß nichts anders." Das war ein Jahr nach der Veröffentlichung von "Nathan der Weise" - einem Werk, das signalisiert, wie im intellektuellen Protestantismus zugleich gerungen wurde um eine Neuformulierung des Gottesbildes im Sinne einer auch die Vernunft noch bindenden Religiosität.
Das ist jedoch nicht mehr Anliegen Nietzsches. Trotz seines erklärten Unbehagens angesichts der "Verdüsterung" eines Europas, das sich über Jahrhunderte gesichert sah im christlichen Glauben, versteht er, in beschwörendem Ton vorgetragen, seine Botschaft als Befreiung, "wie eine neue schwer zu beschreibende Art von Licht, Glück, Erleichterung, Erheiterung, Ermutigung, Morgenröte". Und er präzisiert: "In der Tat, wir Philosophen und 'freien Geister' fühlen uns bei der Nachricht, daß der 'alte Gott tot' ist, wie von einer neuen Morgenröte angestrahlt" - SA 2, S. 206.
Dieses Motiv von Befreiung findet sich im 20. Jahrhundert dann in vielfältiger Weise wieder, in einem weiten Spektrum, das vom Existentialismus Sartres und der Metaphysikkritik Heideggers über Bertrand Russells "Warum ich kein Christ bin" bis zu Tilmann Mosers psychoanalytisch grundierter "Gottesvergiftung" reicht. Auch die paradox anmutende Position Dietrich Bonhoeffers, die sich artikuliert in der Formulierung "vor Gott und mit Gott leben wir ohne Gott", kündet von der Befreiung von einem Orientierung verheißenden Gottesbild und der entschiedenen Zuwendung zur Innerweltlichkeit menschlicher Gemeinschaft.
Eine besondere Konsequenz ist die vor allem in Großbritannien geführte Debatte um eine posttheistische Theologie in den 1960er Jahren, in Deutschland aufgegriffen etwa durch den Historiker Thomas Großbölting, seit 2022 Direktor der "Akademie der Weltreligionen" an der Universität Hamburg. Auch der evangelische Theologe Eberhard Jüngel hatte sich zeitlebens der theismuskritischen, von Gott als Ordnungsprinzip von Welt und Geschichte absehenden Begründung von Theologie gewidmet. Ihm zufolge habe "Bonhoeffer für die Heimkehr der Rede vom Tode Gottes in die Theologie den Boden bereitet" (Jüngel 1977, S. 73).
Doch zurück zu Nietzsche. Für den Gießener Theologen Philipp David ist er der "Denker des Übergangs" zwischen der Geborgenheit in Gott aber auch der Großmächtigkeit des Menschen in der Gottesebenbildlichkeit und einer Zukunft als "Übermensch" radikaler Selbstverfügung. David sieht in ihm den Analytiker einer katastrophalen Zeit des "Nihilismus" - den Nietzsche keineswegs propagiert, sondern lediglich diagnostiziert habe. Was bereits Camus anmerkte (s. David 2023. S. 303).
In der Parabel "Der tolle Mensch" ("Die fröhliche Wissenschaft", Drittes Buch) wird der Tod Gottes zu einer Ungeheuerlichkeit: "Wir haben ihn getötet - ihr und ich! Wir alle sind seine Mörder!" (SA 2, S. 127). Es fällt schwer, darin nichts weiter als einen pathetisch überhöhten Ausweis des Nihilismus zu sehen. Wie auch in der oben zitierten Passage aus dem Fünften Buch von "Die Fröhliche Wissenschaft" wird hier Anklage geführt, ein Missstand benannt, nicht nur eine Befreiung gefeiert. Und wo Befreiung anklingt, geht es einzig um die Lösung vom "christlichen Gott", vom "alten Gott" - explizit gemacht auch im Kapitel "Außer Dienst" im "Vierten und letzten Teil" von "Also sprach Zarathustra".
Eberhard Jüngel unterscheidet an der Rede vom Tod Gottes eine theologische, festgemacht an Dietrich Bonhoeffer, und eine atheistische, festgemacht an Friedrich Nietzsche. Aus christlicher Sicht mag er damit richtig liegen - auch wenn wir zur Kenntnis nehmen sollten, dass auch Franz Overbeck, liberaler Theologe und Wegbegleiter des "Nihilisten" Nietzsche, ganz ähnliche Gedanken wie sein Freund entwickelte, aber statt vom "Tod Gottes" zu sprechen das "Finis Christianismi" thematisierte. Orientieren wir uns allerdings am Gottesbegriff einer Abwesenheit, wie er sich im Zimzum-Konzept der Kabbala artikuliert, rücken Bonhoeffer und Nietzsche näher zusammen, als die klare Unterscheidung in eine nihilistische und eine theologische Rede vom Tod Gottes nahelegt.
Festzuhalten bleibt allerdings, dass Nietzsche nicht die Möglichkeit sah, den christlichen Gott aus der Sterblichkeit Christi neu zu denken, wie dies Hegel unternahm, den Jüngel als entscheidenden Denker einer Theologie nach dem Tod Gottes im Denken der Aufklärung ansieht. Für Jüngel habe "Hegel den Tod Jesu Christi ausdrücklich als Sterben des Göttlichen aufgefasst wissen wollen" (Jüngel 1977, S. 102). Er kann sich dafür auf Hegels Schrift "Glauben und Wissen" beziehen - und auf das Kapitel "Die offenbare Religion" in der "Phänomenologie des Geistes" mit jenem in der Hegel-Rezeption wenig gewürdigten Denksatz zum "unglücklichen Bewußtsein", "es ist der Schmerz, der sich als das harte Wort ausspricht, daß Gott gestorben ist".
Nietzsches Aversion gegen Hegel ist bekannt. Er warf ihm den Versuch vor, den Glauben zu beweisen und dabei die "Unterwerfung des Philosophen unter die Wirklichkeit" zu rechtfertigen (SA 3, S. 447).
Lektüreempfehlungen:
Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden, hrsg. von Karl Schlechta (Schlechta-Ausgabe/SA), München: Hanser, 1965/66
Eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, Tübingen: Mohr, 1977
Philipp David, Der Tod Gottes als Lebensgefühl der Moderne, Tübingen: Mohr Siebeck, 2023
Der persönliche Gott bei Edith Stein - Das unwiederholbare Gottessiegel
Edith Stein wurde am 12. Oktober 1891 in Breslau geboren und am 09. August 1942 in Auschwitz-Birkenau ermordet.Kurz nach der Freigabe des Hochschulstudiums für Frauen in Preußen 1908 schrieb Edith Stein sich 1911 in Breslau für Philosophie, Psychologie, Geschichte und Germanistik ein. Nach der Lektüre von Edmund Husserls „Logische Untersuchungen“ wechselte sie 1913 zur Philosophie bei Husserl in Göttingen, wo sie bald bei ihm mit einer Promotion über den Begriff der Einfühlung begann. Als Husserl im April 1916 einem Ruf nach Freiburg folgte, schickte sie ihm das dreibändige Manuskript ihrer Arbeit nach. Auf Husserls positive Reaktion bot sie ihm an, als seine private Assistentin nach Freiburg zu kommen, was Husserl annahm. Anfang August legte sie in Freiburg bei ihm ihr Rigorosum ab.
Neben ihren philosophischen Arbeiten engagierte sie sich schon früh sozial. 1915 hatte sie sich nach dem pädagogischen Staatsexamen zu einem freiwilligen Lazarett-Einsatz in Mährisch-Weißkirchen, an der Karpatenfront, gemeldet. 1918 pflegte sie Husserl während einer schweren Krankheit - nach dem Zeugnis des Husserl-Schülers Fritz Kaufmann. Im gleichen Jahr gibt sie die Assistentenstelle bei Husserl auf, da Husserl ihr die Habilitation verweigerte mit dem Verweis darauf, dass dies für Frauen noch nicht gestattet sei.
Zur Enttäuschung durch die Verweigerung einer Laufbahn als Hochschullehrerin trat in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg als Belastung ein Bruch in der Freundschaft mit dem Kommilitonen Roman Ingarden, der nach seiner Promotion 1918 Freiburg verlassen hatte. Stein beschäftigte sich in diesen Jahren intensiv mit dem christlichen Glauben, was Ingarden befremdete. Beeindruckt war sie unter anderem durch ihre ältere Freundin Anna Reinach, die 1916 zusammen mit ihrem Mann Adolf, einem Mentor und Freund Steins, in die evangelische Kirche eingetreten war und nach dem Tod ihres Mannes - als Kriegsfreiwilliger 1917 - in der Religion Zuflucht fand. Kurzzeitig engagierte Stein sich nach dem Kriegsende auch politisch in der linksliberalen DDP (Deutsche Demokratische Partei), zog sich aber rasch aus dem parteipolitischen Geschehen zurück und engagierte sich nun frauenpolitisch als Vortragsrednerin.
1922 konvertierte Stein zum Katholizismus, sah dies allerdings nicht als Bruch mit ihrer jüdischen Prägung an, sondern in Kontinuität, und nahm den Taufnamen „Teresa“ an. Die Autobiographie der Teresa von Avila hatte sie 1921 studiert. Dann arbeitete sie als Lehrerin und Pädagogik-Dozentin in Speyer, in einer Einrichtung der Dominikaner, gerät aber 1933 als „Nicht-Arierin“ in Bedrängnis und kündigt das Anstellungsverhältnis, das ohnedies schon mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten zunehmend in Konflikt geraten war. Im Herbst 1933 trat sie in den Karmel Köln-Lindenthal ein, 1935 wurde sie für ihre Arbeit an "Endliches und ewiges Sein", die sie dann Anfang 1937 abschloss, von klösterlichen Verpflichtungen entbunden. Am Silvesterabend 1938 verließ sie Deutschland und fand Zuflucht im Karmel Echt, wenig entfernt von der deutsch-niederländischen Grenze. Am 7. August 1942 wurde sie zusammen mit ihrer Schwester Rosa vom niederländischen Sammellager Westerbork nach Auschwitz deportiert, wo beide am 9. August getötet wurden.
Papst Johannes Paul II. hat sie am 01.05.1987 seliggesprochen und am 11.10.1998 heilig. Er erklärte sie 1999 zusammen mit Katharina von Siena und Birgitta von Schweden zur Patronin Europas, neben bereits zuvor ernannten drei Männern.
*
Die wesentliche Schrift Steins zum Verständnis ihrer Gottesauffassung ist "Endliches und ewiges Sein", entstanden im Kölner Karmel, geplant zunächst als Druckvorbereitung ihres ursprünglich zur Habilitation vorgesehen Manuskripts "Potenz und Akt", wozu sie von Theodor Rauch, ihrem Provinzial, beauftragt war. Nach kurzer Zeit entschied sich Stein, nur einen kleinen Teil des Manuskripts zu übernehmen und eine neue Arbeit zu verfassen, die nach weniger als zwei Jahren abgeschlossen war, mit zwei Anhängen, zu Martin Heidegger und zu Teresa von Avila. Im Vorwort zu diesem Werk, das in der Stein-Forschung als ihr "Opus magnum" gilt, schreibt sie "Dieses Buch ist von einer Lernenden für Mitlernende geschrieben."
In Kapitel VII, "Das Abbild der Dreifaltigkeit in der Schöpfung", zeigt Edith Stein den Weg von der Suche nach dem Sinn des Seins zum "Urheber" allen endlichen Seins, zum dreifaltigen Gott. Diese Dreifaltigkeit nun sei auch in der Schöpfung als dem "Abbild der Drei-Einheit" zu finden. Stein führt zunächst aus, dass die Dreifaltigkeit als "dreipersönliches Sein" zu verstehen sei (Stein 2006, S. 303). Das Ganze der Schöpfung ist dann jedoch nicht ihr Thema, es geht nur noch um den Menschen als Schöpfung, den Menschen in seinem "leiblich-seelisch-geistigen" Sein, womit sie die gesuchte Dreiheit in der Schöpfung als "persönlich" identifiziert. Sie ist "zum menschlichen Sein als dem uns vertrautesten zurückgekehrt, an dem uns am ehesten der Sinn des Personseins klar werden kann" (Stein 2006, S. 323). Darüber hinaus kommt sie nur noch zu den rein geistigen Wesen als Teile der Schöpfung, den Engeln, in Paragraph 5, überschrieben mit "Die geschaffenen reinen Geister". Ausgehend von Thomas von Aquin entfaltet sie dort, aus heutiger fachphilosophischer Sicht eher befremdlich, in knappen Zügen die "Möglichkeit einer philosophischen Behandlung der Engellehre" (Stein 2006, S. 323). Dabei geht es ihr um die "Wesenserkenntnis des Geistes" (ebd. S. 327). Engel sind in ihrer Argumentation gleichsam ein missing link vom persönlichen Menschsein zum göttlichen Geist.
Paragraph 9 des Kapitels VII gilt dann dem "Gottesbild im Menschen". Das Kapitel beginnt mit der erneuten Bekräftigung der Konzeption eines persönlichen Gottes, seiner "Hineingestaltung in den Raum". Höchste Form dieser Hineingestaltung ist der Mensch, als einziges Geschöpf mit einer Persönlichkeit, die ihn zum "bildenden Geist" macht und damit zum unmittelbaren Abbild Gottes (Stein 2006, S. 360) - auch wenn die Tierseele bereits eine "Vorstufe geistigen Lebens" erreiche. Zum Abschluss des Paragraphen entfaltet sie ihre Überzeugung von der "dreifaltigen Formkraft der Seele" in "Leib-Seele-Geist", die umfassend die Dreifaltigkeit Gottes im Menschen belege (Stein 2006, S. 390). Denn die Seele forme auch den Leib, sei diesem nicht feindlich gegenüber gestellt. Eine Konzeption des persönlichen Gottes, die sie auch sehr prägnant in ihrer Übersetzung der Hauptschriften des Dionysius Aerophagita, "Von den göttlichen Namen" und "Kirchliche Hierarchie", herausarbeitet (vgl. z.B. Band 17 der Gesamtausgabe, Seite 236, Abschnitt VII.3 des Textes "Kirchliche Hierarchie").
Im Kapitel VIII, "Sinn und Begründung des Einzelseins", schreibt sie dann:
„Wir glauben jetzt ein wenig besser zu verstehen, daß die Abstammung des Menschen von menschlichen Erzeugern ihn an Leib und Seele zu ihresgleichen macht und daß er sich trotzdem rühmen darf, unmittelbar ein Gotteskind zu sein und ein eigenes unwiederholbares Gottessiegel in seiner Seele zu tragen.“ (Stein 2006, S. 433)
Verstehen lässt sich Edith Steins Ansatz auch als ein Versuch, Heideggers Seins-Philosophie gleichsam umzuwenden. Heidegger geht in "Sein und Zeit" bei der Frage nach dem Sinn des Seins vom Seienden des Menschen aus. Stein geht bei der Frage nach dem Sinn menschlicher Existenz vom höchsten Seienden, Gott, aus. Es zeigt sich hier eine gewisse Analogie zu ihrem Umgang mit der Glaubenslehre der Teresa von Avila, "Die Seelenburg" (neu als "Wohnungen der Inneren Burg"). Während Teresa die menschliche Seele als den Ort der Gottesbegegnung ansieht, vom "Abstieg ins Innere" spricht, wählt Stein in "Wege der Gotteserkenntnis" und "Kreuzeswissenschaft", in den Auseinandersetzungen mit Dionysius Areopagita und Johannes vom Kreuz, das Bild vom Aufstieg auf den "Gipfel des Berges". Nach Auffassung ihrer Herausgeberin Beate Beckmann entspricht dieses Bild eher ihrer eigenen Auffassung (ESGA 17, S. 2f).
Steins Gottesbild ist essentiell mit ihrem Menschenbild verbunden. Und dies nicht in jenem banalen Sinn, dass Gott nach dem Bild des Menschen und seiner Bedürfnisse gestaltet sei. Ihr Gott ist Person, ist in einem schwer zu fassenden Sinne einzeln, ist Gegenüber, ist Partner - und dies in jedem Menschen, der uns begegnet, der ihr, Edith Stein, begegnete. Das ist nicht einfach nur eine Neuauflage des anthropomorphen Gottesbildes. Der persönliche Gott Edith Steins ist zwar ansprechbar, aber keineswegs der nette alte Herr mit Bart, sondern eine philosophisch aufgeklärte Vorstellung, die in den Grundzügen dem Gott Descartes in den "Meditationen" (Dritte Meditation) entspricht, wonach "die Vorstellung Gottes der des Ich vorausgeht". Das "Ich bin" ist damit gleichbedeutend mit "Gott ist", der Gottesbeweis Edith Steins lautet: Ich bin, also ist Gott.
Quelle: Edith Stein, Endliches und ewiges Sein, Edith Stein Gesamtausgabe (ESGA) Bd. 11/12, Freiburg 2006
Lektüreempfehlung: Tonke Dennebaum, Freiheit, Glaube, Gemeinschaft. Theologische Leitlinien der Christlichen Philosophie Edith Steins, Freiburg 2018
Simone Weil - der abwesende Gott
Simone Adolphine Weil wurde am 03. Februar 1909 als Tochter liberaler Juden ohne Bezug zur religiösen Praxis in Paris geboren. Der Vater war Arzt und stammte aus Straßburg, die Mutter stammte aus Rostow am Don, kam aber schon als Kleinkind mit den Eltern nach Antwerpen und übersiedelte als junge Frau nach Paris. Simone Weils von ihr sehr geschätzter jüngerer Bruder André wurde zu einem der einflussreichsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts.Die Biographie Weils ist geprägt durch ein frühes gewerkschaftliches Engagement und ein ausgesprochenes Interesse an den Belangen der Arbeiterschaft. Vieles erinnert an Formen des politischen Engagements in der späteren Schüler- und Studentenbewegung der 1960er und 70er Jahre. Nach einer Ausbildung für den Gymnasialunterricht arbeitete sie ab Herbst 1931 an einer Mädchenoberschule in Le Puy, wo sie von der Presse ihres politischen Engagements wegen bald als "Agentin Moskaus" und "rote Jungfrau" tituliert wurde. Im Spätsommer 1932 reiste sie zwei Monate durch Deutschland und berichtete über ihre Erfahrungen dort in Gewerkschaftszeitungen. Nach einer Versetzung an eine Schule in Auxerre lässt sie sich im Herbst 1934 vom Schulunterricht beurlauben, um in verschiedenen Betrieben die Arbeitswelt unmittelbar zu erfahren. Zuletzt arbeitete sie, nach zwischenzeitlicher Arbeitslosigkeit, auch eine Zeitlang bei Rénault, meist im Akkord. Im Herbst 1935 tritt sie eine Stelle am Mädchengymnasium in Bourges an. Im Frühjahr 1936 arbeitete sie auf einem Bauernhof, ohne Rücksicht auf ihre körperliche Eignung für die schwere Arbeit, Erleichterungen lehnte sie ab.
Im Sommer 1936 engagierte sie sich im Spanischen Bürgerkrieg, es existieren auch zwei Fotos dazu, die sie in Uniform zeigen, freundlich lächelnd mit geschultertem Gewehr. Allerdings war sie nie im direkten Kampfeinsatz, ihr in der Sammlung "Krieg und Gewalt" zugängliches "Spanisches Tagebuch" ist dennoch höchst aufschlussreich. Auch dieses Engagement endete frühzeitig, nach zwei Monaten, in Folge einer schweren Fußverletzung durch siedendes Speiseöl. Nach einem Jahr der Erholung und dem Abfassen verschiedener Schriften, darunter "Ne recommençons pas la guerre de Troie" (in "Krieg und Gewalt" auf Deutsch veröffentlicht), einer fundamentalen Abrechnung mit Militarismus, Nationalismus und Patriotismus, tritt sie im Herbst 1937 den Schuldienst an der Mädchenmittelschule von Saint-Quentin an, lässt sich aber schon bald wegen heftiger Kopf- und Nervenschmerzen beurlauben. Ostern 1938 verbringt sie mit der Mutter zehn Tage in der Benediktinerabtei Saint-Pierre in Solesmes, bekannt schon damals für die Pflege des gregorianischen Gesanges. "Ich hatte bohrende Kopfschmerzen; jeder Ton schmerzte mich wie ein Schlag; und da erlaubte mir eine äußerste Anstrengung der Aufmerksamkeit, aus diesem elenden Fleisch herauszutreten, es in seinem Winkel hingekauert allein leiden zu lassen und in der unerhörten Schönheit der Gesänge und Worte eine reine und vollkommene Freude zu finden." (Weil 1952, S. 19).
Mit dieser Schilderung aus dem berühmten Brief an den Dominikanerpater Joseph-Marie Perrin vom Mai 1942, ihrer "autobiographie spirituelle" (Weil), dokumentiert Weil den Beginn ihrer Zuwendung zu einer sehr persönlichen, wenig durch Lektüre (wichtige Ausnahme in den letzten Lebensjahren: Johannes vom Kreuz) inspirierten Mystik. Dennoch verfolgt sie weiter das politische Geschehen und bezieht in Texten, die jedoch nicht veröffentlicht werden, Stellung. Beim deutschen Einmarsch in Frankreich flieht sie mit den Eltern nach Vichy. Als sie im Juli 1940 um eine neue Schulstelle bittet, erhält sie keine Antwort. Sie vermutet als Hintergrund die "Judenstatuten" und argumentiert in einem Schreiben an das Unterrichtsministerium mit subtiler Ironie gegen ihre Zuordnung als Jüdin, da ihre Großeltern wenig bis gar nicht religiös gewesen seien und sie auch nicht von einer relevanten genetischen Beziehung zum Volk des Alten Testamentes ausgehen könne. "Im Übrigen gebe es für sie nur eine französische, griechische und christliche Tradition; die hebräische sei ihr vollkommen fremd" (Wimmer 2009, S. 21).
1941 möchte sie wieder auf einem Bauernhof arbeiten. Ihr wird von Perrin der Kontakt mit dem Philosophen Gustave Thibon vermittelt, der auf dem Lande in Saint-Marcel d'Ardèche lebt, sie aufnimmt und sich um eine bäuerliche Arbeitsstelle kümmert, später um eine Arbeit bei der Weinlese. Abends trug sie Thibon ihre Auffassung von Platon vor, den sie im griechischen Original las. Ihr Gastgeber berichtete auch, dass sie sehr wenig aß, dennoch unerbittlich tagsüber die Landarbeit erledigte. Bei ihrem Abschied von Thibon nach Marseille zu ihren Eltern überließ sie diesem ein Konvolut von etwa "zehn dicken Heften" (Weil 1952, S. 249). Aus diesem Konvolut veröffentlichte Thibon 1947 den Band "La Pesanteur et la Grâce".
Am 14. Mai 1942 emigrierte sie von Marseille aus gemeinsam mit den Eltern nach New York, kehrte jedoch am 10. November des gleichen Jahres nach Europa zurück, nach England, um für die französische Exilregierung zu arbeiten. Sie schrieb unter anderem an einer neuen Erklärung der Menschenrechte, die den Begriff der Pflicht ins Zentrum stellte, nicht die Rechte. Am 15. April 1943 wurde sie auf Veranlassung einer Freundin in ein Krankenhaus eingewiesen, diagnostiziert werden Unterernährung und Lungentuberkulose. Am 17. August wird sie in ein Sanatorium in Ashford/Kent verlegt, wo sie am 24. August stirbt, an Herzmuskelschwäche. Sie hatte schon im Krankenhaus die Nahrungsaufnahme weitgehend verweigert, mit dem Verweis auf die hungernden französischen Kriegsgefangenen und Kinder.
*
Simone Weil gilt als Zeugin für die Vorstellung vom "abwesenden Gott" im 20. Jahrhundert. Dabei können ihre Interpreten sich vor allem auf einen Aphorismus in der Nachlasspublikation "Schwerkraft und Gnade" stützen, der da lautet "Gott kann in der Schöpfung nicht anders anwesend sein als unter der Form der Abwesenheit." (Weil 1952, S. 150). Gedeutet wird dies zumeist vor dem Hintergrund von Zweitem Weltkrieg und Shoa, welche die Abwesenheit Gottes bezeugten. Weil selbst nennt einen solchen Zusammenhang jedoch nie.
"Vier Dinge auf Erden" seien nach Weil "ein Zeugnis der göttlichen Barmherzigkeit". Darunter als viertes "die gänzliche Abwesenheit der Barmherzigkeit hienieden". Genannt nach der "Schönheit der Welt", die an dritter Position steht (Weil 1952, S. 153). Diese paradox anmutende Gedankenführung verweist prägnant darauf, dass Weil die "Abwesenheit Gottes" grundsätzlich philosophisch begründet, nicht aus einer ihr persönlich gegenwärtigen Unheilserfahrung.
In einer ihrer Notizen aus dem Nachlass heißt es: "Ein Mensch, dessen sämtliche Angehörigen unter der Folter umgekommen wären, der selbst lange Zeit in einem Konzentrationslager gefoltert worden wäre. Oder ein Indio des sechzehnten Jahrhunderts, der als einziger der völligen Ausrottung seines ganzen Volksstammes entkommen wäre. Wenn solche Menschen an die Barmherzigkeit Gottes geglaubt haben, so glauben sie nun entweder nicht mehr daran oder ihre Vorstellung davon hat sich von Grund auf gewandelt." (Weil 1952, S. 157f). Weil erklärt in dieser Notiz dann, sie selber habe keine vergleichbare Erfahrungen gemacht, aber sie wisse darum, und damit seien sie auch für sie real. Ihre Konsequenz war nun offenkundig nicht, den Glauben an die Barmherzigkeit Gottes aufzugeben, sondern ihn zu "wandeln".
Gottes Abwesenheit gerade als ein Zeichen seiner Anwesenheit zu begreifen, ist die innerste Auszeichnung der Weilschen Gottesauffassung. Nur so wird auch verständlich, wie sie sagen kann: "Von zwei Menschen ohne Gotteserfahrung ist der, welcher ihn leugnet, ihm vielleicht am nächsten." (Weil 1952, S. 156) Denn wer Gott nicht leugnet, hält ihn in der Regel für "irgendwie" anwesend, potentiell eingreifend. Was Weil strikt ablehnt. Gott ist für Weil erfahrbar, innerlich - was aber bedeutet, dass uns innerlich ein Bereich zugänglich ist, der außerhalb der Welt des Eingreifens und Handelns liegt.
Die Vorbereitungen zum Zweiten Weltkrieg versteht Weil nach dem Modell des Trojanischen Krieges als Konflikt, der "kein bestimmbares Ziel" habe, nachzulesen in ihrem Essay "Beginnen wir den Trojanischen Krieg nicht von Neuem", geschrieben 1937 (Weil 2011, S. 37). Damit meint sie nicht, dass es keine Kriegsgründe oder Kriegsrechtfertigungen gebe. Die gibt es zuhauf und sie setzt sich mit denen auch auseinander, insbesondere mit den "großen Worten" wie "Nation", "Sicherheit", "Demokratie" und so fort. Was sie meint ist ein bestimmbares Ziel, das in einer realen und begründbaren Beziehung zu Aufwand, Leid und Zerstörung steht. Das fehle.
Davon rückt sie auch 1943 nicht ab, als sie den zwischenzeitlich ausgebrochenen Krieg zu einem "Krieg von Religionen" erklärt. Wobei sie "Religion" soziologisch versteht als "Anbetung der sozialen Realität unter verschiedenen Götternamen" (Weil 2011, S. 206). Als eigentliche Ursache des Krieges sieht sie in diesem späten Aufsatz das Erlöschen der Bindekraft des Christentums, die Ungläubigkeit in einem nicht konfessionell gemeinten Sinne. "Europa leidet an einer inneren Krankheit. Es bedarf der Heilung." (Weil 2011, S. 213). Und die Heilung sieht sie im "Hervorbrechen eines wirklichen Glaubens" (ebd.). Dieser Glaube bedarf einer inneren Erfahrung, die zu gewinnen Unglück helfen könne. Weils abwesender Gott unterscheidet sich vom biblischen in einer wesentlichen Hinsicht. Während der Deus absconditus sich über Zeichen kundtut, ist der Gott Weils nur innerlich erfahrbar.
Weil weist der inneren Erfahrung nicht nur hier eine entscheidende Funktion zu, sondern auch in ihrer Vorstellung des Guten: "Einwilligung in das Gute, nicht in irgendein greifbares, vorstellbares Gutes, sondern bedingungslose Einwilligung in das unbedingte Gute" (Weil 1952, S. 151). Dies erklärt auch ihre Leidenschaft für Platon, während sie Aristoteles strikt ablehnte. Weils Gott entspricht dem Guten Platons (vgl. Wimmer 2009, S. 262). Ihr Gottesbild verweist uns auch zurück auf die alte Diskussion, ob Platon als Monotheist zu begreifen sei oder zumindest monotheistische Züge reflektiere.
Lektüreempfehlungen:
Simone Weil, Schwerkraft und Gnade. Übersetzt von Friedhelm Kemp, München: Kösel-Verlag, 1952 (frz. 1947 als "La Pesanteur et la Grâce")
Simone Weil, Krieg und Gewalt. Essays und Aufzeichnungen. Übersetzt von Thomas Laugstien u.a., Zürich: Diaphanes, 2011 (zuerst frz. in Einzelpublikationen)
Reiner Wimmer, Simone Weil. Person und Werk, Freiburg u.a.: Herder, 2009
Die Namen Gottes
Der Physiker, Mathematiker und Astronom Arthur C. Clarke
(1917-2008) las während seiner Kindheit auf einem englischen
Bauernhof leidenschaftlich gerne amerikanische Science
Fiction Literatur, wofür er sein ganzes Taschengeld opferte.
Früh begann er mit dem Schreiben eigener SF-Erzählungen.
Seine ersten professionellen Veröffentlichungen erschienen
in „Astounding“ im Jahr 1946, so vor allem eine seiner
erfolgreichsten Geschichten, „Rescue Party“. 1948
veröffentlichte er seine - indirekt - bekannteste
Geschichte, „The Sentinel“, auf der Stanley Kubricks Film
„2001. Odyssee im Weltraum“ beruht. „The Nine Billion Names
of God“ schrieb er im Mai 1952 in New York.Bis zum letzten Satz liest sich dieser Text bei vordergründiger Lektüre wie eine Verhöhnung bigotter buddhistischer Mönche, die einer Wahnidee frönen, nämlich dem Plan, alle Namen Gottes niederzuschreiben, die sich aus einem Alphabet aus neun Buchstaben, über das wir nichts Näheres erfahren, bilden lassen – unter Beachtung einiger Regeln, von denen wir nur eine kennenlernen, nämlich die Regel, dass kein Buchstabe mehr als dreimal hintereinander erscheinen dürfe.
Der Lama des Klosters, das sich dieser Aufgabe widmet, reist in die USA, um bei einem Computerbauer zwei Rechner und das zugehörige Personal auf drei Monate zu leihen, damit die bislang händisch durchgeführte Arbeit beschleunigt werden könne. Denn ohne Rechnerunterstützung würde das Projekt etwa 15.000 Jahre benötigen, mit Rechner einige hundert Tage, trägt der Lama vor.
Zwei Computertechniker reisen aus den USA nach Tibet, in die Berge des Himalaya, um das Projekt umzusetzen. Sie langweilen sich entsetzlich in der klösterlichen Abgeschiedenheit und erschrecken, als der Lama einem von ihnen das Resultat des Schreibprojektes offenbart: Sind alle Namen Gottes ausgeschrieben, endet die Welt. Für die buddhistischen Mönche eine Verheißung, für die beiden amerikanischen Techniker eine Bedrohung. Denn was wird geschehen, wenn die Verheißung nicht eintritt – wovon die nüchternen Amerikaner selbstverständlich ausgehen? Wird eine wütende Mönchsschar sie zur Rechenschaft ziehen, gar töten? So machen die beiden sich unter Einsatz einer kleinen Manipulation am Rechner aus dem Staub, ehe der letzte Gottesnamen niedergeschrieben ist.
Erst im letzten Satz der Geschichte zeigt sich, dass der Autor auf der Seite der Mönche steht, dass die selbstbewußt aufgeklärten Programmierer bei ihm die eigentlichen Narren sind. Als die beiden sich dem Flugzeug nähern, das sie vermeintlich sicher vor der erwarteten Rache der Mönche zurück in die Heimat bringen sollte, erlöschen die Sterne: „Overhead, without any fuss, the stars were going out.“ (Clarke 1974, S. 13).
Die Vorstellung einer endlichen Schöpfung ist bereits in der Heilsgeschichte des Christentums enthalten. Und sie verträgt sich mit der Theorie des (zunächst kritisch so genannten) Big-Bang, des Urknalls, die unmmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Aufsehen erregte. Clark rekurriert mit seinem Plot allerdings auf die Bedeutung des Gottesnamens in den monotheistischen Religionen. In der Kabbalah begegnen uns verschiedene Konzepte, die mit einer bestimmten Anzahl an Gottesnamen operieren. Da sind zum einen die 10 Sefirot am Lebensbaum, denen 10 Eigenschaften und damit Namen Gottes entsprechen. Im 13. Jahrhundert leitete der spanisch-jüdisch-arabische Kabbalist Abraham Abulafia aus dem Buch Exodus 72 Namen Gottes ab, die jeweils durch eine Buchstabentriade gebildet sind. Sie entsprechen den 72 Engeln des Tanach, womit ein Aussprechen des Ha-Shem Ha-Mephorash, des vollständigen Gottesnamens, umgangen wird. Ist doch der vollständige Gottesnamen seit der Zerstörung des Tempels von Jerusalem tabuisiert. Der Koran kennt mehr als 100 Namen/Attribute Gottes, es gibt allerdings auch das Konzept der 99 "besten/schönsten/herrlichsten Namen Gottes", asmāʾ Allāh al-ḥusnā - überliefert in einem Hadith von Abū Huraira. In seinem Gedicht "Talismane", das beginnt mit "Gottes ist der Orient!/Gottes ist der Okzident!" spricht Goethe von den "hundert Namen" Gottes.
1966 redigierte Clark eine Sammlung seiner Kurzgeschichten, die insgesamt den Titel „The Nine Billion Names of God“ trägt und mit unsere Erzählung beginnt, deren Entstehungsgeschichte er kurz erläutert in einem Vorspann. Jahrzehnte später schickte der Autor diesen Band (sowie seine Essay-Sammlung „Spring: A Choice of Future“) an den Dalai Lama, der ihm im Februar 1997 kurz und freundlich dankt und die titelgebende Geschichte als „particularly amusing“ heraushebt. Clarke bezeichnete diese Antwort in seinen „Collected Stories“ als „a charming response from the highest possible authority“. Zusammen mit anderen Äußerungen Clarkes lässt dies darauf schließen, dass der Autor die Geschichte durchaus auch theologisch ernst genommen sehen wollte, nicht in all ihren Konsequenzen, aber doch in den impliziten Erwägungen.
Quelle: Arthur C. Clarke, The Nine Billion Names of God, New York: New American Library, 1974
Der Fall Rautavaara
Noch eine zweite bemerkenswerte Auseinandersetzung mit
Gottesbildern aus der Science Fiction möchte ich vorstellen.
Philip Dick (1928-1982) veröffentlichte 1980 die kurze
Erzählung "Rautavaara's Case". Darin verunglückt ein
kosmischer Reparaturservice von der Erde mit seinem
Raumschiff in einem fernen Sonnensystem. Dabei sterben zwei
Besatzungsmitglieder, das dritte, eine Frau namens Agneta
Rautavaara, überlebt dankt der Intervention einer fremden
Intelligenz, allerdings nur als Gehirn, ihr Körper wird -
aufgelöst in seine Bestandteile - von den Rettern dazu
benutzt, das Gehirn am Leben zu erhalten. Dieser Frau,
diesem Gehirn erscheint dann Christus, der sich zunächst
schon klischeehaft bibelgemäß verhält und auch so spricht.
Die fremde Intelligenz beobachtet dies und beschließt, in
das Gehirn Rautavaaras die eigene Gottesvorstellung
einzuschleußen. Schockiert muss Rautavaara dann mit
anschauen, wie das, was sie für Christus gehalten hatte,
einen der beim Unfall verstorbenen Besatzungskollegen
Rautavaaras aufisst mit den Worten "Er ist mein Leib. (...)
Indem ich seinen Leib esse, erlange ich ewiges Leben. Dies
ist die neue Wahrheit, die ich jetzt verkünde".Die fremde Intelligenz ist mit dieser Entwicklung hoch zufrieden und betrachtet den Vorgang als wissenschaftliches Experiment mit theologischer Relevanz, das weiter verfolgt werden sollte. Das Gehirn Rautavaaras erlaube einen Blick in das Leben nach dem Tode. "Mit Hilfe ihres beschädigten Hirns, das von einem fehlgeleiteten Roboter wiederhergestellt war, standen wir in Verbindung mit der nächsten Welt und den Mächten, die sie beherrschten." (Dick 2000, S. 295) Die entscheidende theologische Differenz mit den "Erdmenschen" benennt die fremde Intelligenz, die als "polyenzephales" Plasma existiert, wie folgt: "Sie trinken das Blut ihres Gottes; sie essen sein Fleisch; so werden sie unsterblich. (...) Ein Greuel, eine Schande - eine einzige Abscheulichkeit. Das Höhere sollte sich immer vom Niedrigeren ernähren; der Gott sollte die Gläubigen verzehren." (Dick 2000, S. 301) Der von den "Erdmenschen" beantragte Untersuchungsausschuss sieht jedoch in den Wahrnehmungen Rautavaaras nichts weiter als Halluzinationen und verfügt die Abschaltung des Gehirns.
Was Dick hier beschreibt, ist eine durchaus auch im christlich-jüdischen Kontext anzutreffende Konzeption. So hat Reiner Wimmer in "Simone Weil. Person und Werk" 2009 in der Anmerkung 300 darauf hingewiesen, dass es in den Texten dieser Philosophin öfter die Vorstellung von einem "Verspeist-, Verschlungen- und Verdautwerden" durch Gott gebe.
1975 hatte der Mediziner und Philosoph Raymond A. Moody in den USA sein Aufsehen erregendes Werk über Nahtoderfahrungen veröffentlicht, "Life After Life". Darin teilt er auch mit, dass einige seiner Patienten davon überzeugt sind, Christus begegnet zu sein. In ihrem Vorwort macht die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross deutlich, dass die religiöse Gestalt, von der die Patienten Raymond Moodys (und nebenbei auch ihre eigenen Patienten) erzählten, "natürlich ihren Glaubensüberzeugungen entsprach" (Moody 1977, S. 10). Wir können davon ausgehen, dass Dick diese Publikation kannte (er war äußerst belesen und umfassend gebildet) und sie ihn zu seiner Rautavaara-Geschichte inspirierte, neben eigenen Jesus-Visionen, von denen Dick bereits 1974 berichtete. Sein Text verdient durchaus auch eine Lektüre unter theologischen Gesichtspunkten, auch wenn die saloppe, oft grob nachlässige Schreibweise Dicks dem inhaltlichen Gewicht seiner Erfindung nicht gerecht wird. Es ist anzunehmen, dass er selbst die kulturelle, letztlich auf physiologischen Unterschieden basierende Deutung der beiden unterschiedlichen Christus-Erfahrungen für eher banal hielt. Eine breiter aufgefächerte Auseinandersetzung mit dem Christus-Komplex zeigt seine Valis-Trilogie, an der er in der gleichen Zeit bis kurz vor seinem Tod schrieb.
Quelle: Philip K. Dick, Der Fall Rautavaara, 2000
Lektüreempfehlung: Ramond A. Moody, Leben nach dem Tod, 1977 (zuerst engl. unter dem Titel "Life After Life", 1975)